- Andria
-
Andria 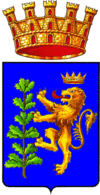
Staat: Italien Region: Apulien Provinz: Barletta-Andria-Trani (BT) Koordinaten: 41° 13′ N, 16° 18′ O41.21666666666716.3151Koordinaten: 41° 13′ 0″ N, 16° 18′ 0″ O Höhe: 151 m s.l.m. Fläche: 407 km² Einwohner: 100.086 (31. Dez. 2010)[1] Bevölkerungsdichte: 246 Einw./km² Postleitzahl: 70031 Vorwahl: 0883 ISTAT-Nummer: 110001 Demonym: Andriesi Schutzpatron: San Riccardo (4. April) Website: Andria Andria ist eine Stadt in der süditalienischen Provinz Barletta-Andria-Trani, Region Apulien. Sie hat 100.086 Einwohner (Stand 31. Dezember 2010) und eine Fläche von 407 km².
Inhaltsverzeichnis
Lage
Die Nachbargemeinden sind Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Spinazzola und Trani.
Geschichte
Andria wurde um 1046 gegründet. Im Jahr 1228 verstarb hier Isabella II. (Jolande), die zweite Ehefrau Friedrichs II., nachdem sie ihm den Sohn Konrad, den späteren Konrad IV., geboren hatte. Andria war einst Lieblingssitz des Kaisers Friedrichs II., der im 13. Jahrhundert das imposante Castel del Monte mit acht Türmen erbauen ließ. In Andria sollen zwei seiner vier Ehefrauen begraben sein. Seit 2008 ist Andria eine der drei Hauptstädte der neu gegründeten Provinz Barletta-Andria-Trani.
Sehenswürdigkeiten
Die Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert mit einer Krypta aus dem 8. Jahrhundert ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten.
Wirtschaft
Der Hauptwirtschaftszweig ist die Winzerei sowie der Oliven- und Mandelanbau.
Söhne und Töchter der Stadt
- Carlo Broschi, genannt Farinelli (1705–1782), berühmter Kastratensänger
- Corrado Kardinal Ursi (1908–2003), Erzbischof von Neapel
- Lino Banfi (*1936), Schauspieler
Literatur
- Karl Baedeker: Unteritalien, 15. Auflage, Leipzig 1911
- Italien Süd, Baedeker 2003
Weblinks
 Commons: Andria – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien
Commons: Andria – Album mit Bildern und/oder Videos und AudiodateienEinzelnachweise
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica vom 31. Dezember 2010.
Gemeinden in der Provinz Barletta-Andria-Trani in der Region ApulienAndria | Barletta | Bisceglie | Canosa di Puglia | Margherita di Savoia | Minervino Murge | San Ferdinando di Puglia | Spinazzola | Trani | Trinitapoli
Wikimedia Foundation.
Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:
Andria — Saltar a navegación, búsqueda Andria Bandera Archivo:Andria Stemma.png Escudo … Wikipedia Español
Andria — Blason Administration Pays … Wikipédia en Français
Andria — may refer to:*Alfonso Andria, (b. 1952), an Italian politician *Andria (comedy), a comedic play by Terence *Andria, Italy, a city in the province of Bari, Apulia, Italy *Diocese of Andria, a Roman Catholic diocese in Italy … Wikipedia
Andria — (Сео де Уржель,Испания) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Passeig Joan Brudieu, 24, 25 … Каталог отелей
-andria — [dal gr. andría, der. di anḗr andrós uomo ]. Secondo elemento di nomi composti della terminologia dotta e scientifica, nei quali significa uomo e, in botanica, stame o elemento maschile … Enciclopedia Italiana
Andrīa [1] — Andrīa (gr. Ant.), die öffentlichen Mahlzeiten bei den Kretensern (s. u. Kreta); vgl. Phiditia … Pierer's Universal-Lexikon
Andrīa [2] — Andrīa, Stadt in der Provinz Terra di Bari (Neapel), Bischofssitz, Kathedrale; Handel mit Mandeln, 22,000 Ew. A. wurde bis 1190 von den Normannen beherrscht; 1221 kam die Stadt unter den Hohenstaufen Friedrich, der ihr viele Privilegien ertheilte … Pierer's Universal-Lexikon
Andrĭa — Andrĭa, Stadt in der ital. Provinz Bari, Kreis Barletta, an der Dampftrambahn Bari Barletta, Sitz eines Bischofs, mit einer Kathedrale, der von den Templern angelegten Kirche Sant Agostino (mit schönem Spitzbogenportal) u.a., Öl und… … Meyers Großes Konversations-Lexikon
Andria — Andria, Stadt in der ital. Prov. Bari delle Puglie, (1901) 49.569 E.; altgot. Kathedrale … Kleines Konversations-Lexikon
Andria — Andria, neapolit. Stadt in der Provinz Terra di Bari, Bischofssitz, Kirchen und andere Gebäude aus der Normannenzeit, ungefähr 22000 E.; viele Mandeln. Friedrichs II., des Hohenstaufen Gemahlinen Jolantha und Isabella sind hier begraben … Herders Conversations-Lexikon


