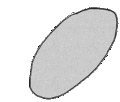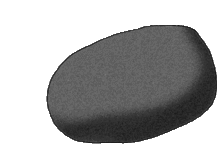- Levalloistechnik
-
Die Levalloistechnik (auch Schildkern-Technik) war die typische Abschlagtechnik des Neandertalers bei der Bearbeitung von Feuerstein. Sie ist bereits während des Acheuléen im Vorfeld der Saaleeiszeit seit mindestens 200.000 Jahren belegt. Daher schlug Gerhard Bosinski im Jahre 1965 vor, die Epoche des Mittelpaläolithikums (= Mittlere Altsteinzeit, traditionell etwa von 100.000 bis 40.000 vor heute) bereits mit dem Auftreten der Levallois-Technik beginnen zu lassen (also vor über 200.000 Jahren).[1][2] Diese Definition des Mittelpaläolithikums hat sich seitdem auch international durchgesetzt.[3] Benannt wurde die Levalloistechnik von französischen Archäologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Funden in einem Vorort von Paris, Levallois-Perret. In den 1920er Jahren führte Henri Breuil den Begriff Levalloisien ein, der heute als Chronostufe jedoch nicht mehr verwendet wird. Verbreitet war diese Technik im Acheuléen, Moustérien und Châtelperronien, das heißt bis zum Ende des Mittelpaläolithikums.
Inhaltsverzeichnis
Technologische Kennzeichen
Gekennzeichnet ist diese Technologie durch eine aufwendige Präparation des Kernsteins, bevor ein Abschlag durch einen einzelnen gezielten Schlag gewonnen werden kann (auch „Schildkern-Technik“ genannt). Die so erzielten Abschläge sind häufig sehr groß und dünn und weisen umlaufend scharfe Kanten auf. Diese Abschlagtechnik rationalisierte den Einsatz des gesuchten Rohstoffes Stein und führte zur Verfeinerung der damit hergestellten Werkzeuge. Es dürfte sich um eine Weiterentwicklung der Clacton-Technik handeln. Hergestellt wurden neben den Levallois-Zielabschlägen auch Klingen, Spitzen und Schaber.
Victoria West-Technik
Diese Technik, benannt nach einer FundsteIle in Südafrika ist lange als Proto-Levalloistechnik angesehen worden.[4] Der Kern, von dem die Abschläge erfolgten, ist hier eher breit als lang. Eine neue Untersuchung zeigt keine genealogischen Zusammenhänge zu Inventaren mit Levalloistechnik in Europa und bezeichnet sie treffender als Para-Levalloistechnik.[5] Daher besteht kein Anlass, die Genese der Levalloistechnik in Südafrika zu verorten.
Levallois-Spitzen
Einige Bearbeiter sind der Ansicht, dass Levalloisspitzen die eigentlichen Zielprodukte der gesamten Levalloistechnik seien. Dabei wird auf der Abbauseite des Kerns durch gegenläufige oder gleichgerichtete Abschlagnegative ein Leitgrad angelegt, der die spitz zulaufende Form der Levalloisspitze ermöglicht.
Die Nutzung von Levallois-Spitzen für Jagdspeere kann mit einem Befund aus Syrien bewiesen werden, wo eine solche Projektilspitze noch im Wirbelknochen eines Wildpferdes steckte. Der Fund wurde in Moustérien-Schichten gemacht.[6]
Zeitgleich gibt es ebenfalls in Syrien einen Nachweis von Schäftungsklebstoff an einer Levallois-Spitze. Das im Gebiet der Levante und Syrien natürlich vorkommende Bitumen bot hier einen frei verfügbaren Klebstoff, der schon vor ca. 50.000 Jahren genutzt wurde.[7]
Kritik des Levallois-Konzeptes
Da in den vergangenen Jahrzehnten unter Levallois-Technik, der Technik des „Präparierten Kerns”, einerseits zum Teil bereits das Vorhandensein zentripetaler Abschlagnegative, andererseits lediglich der präformierte Schildkern verstanden wurde (vgl. Bordes 1980), bestand bis vor wenigen Jahren große Subjektivität in der Ansprache von Levallois-Grundformen.[8] In einem Experiment wurde ein Inventar von Ault (Nordfrankreich) von drei erfahrenen Archäologen unabhängig auf seinen Levallois-Anteil untersucht, wobei nur zu 69% Übereinstimmung in der Ansprache erzielt wurde.[9] Es besteht daher zweifellos ein subjektiver Faktor bei der Klassifikation von Levallois-Grundformen gegenüber anderen Abschlagtechniken.
Fundstellen in Mitteleuropa
- Neumark-Nord im Geiseltal bei Merseburg
- Eythra, Zwochau und Markkleeberg (nahe Leipzig)
- Lübbow und Woltersdorf (Landkreis Lüchow-Dannenberg)
- Salzgitter-Lebenstedt („Lebenstedter Gruppe“, heute ins Micoquien gestellt)
- Rheindahlen (bei Mönchengladbach)
Einzelnachweise
- ↑ Gerhard Bosinski , Abschläge mit facettierter Schlagfläche in mittelpaläolithischen Funden. – Fundberichte aus Schwaben N.F. 17, 1965, S. 5-10
- ↑ Gerhard Bosinski: Die mittelpaläolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa. – Fundamenta A 4. Köln/ Graz (Böhlau), 1967.
- ↑ Gerhard Bosinski: The Transition Lower/Middle Paleolithic in Northwestern Germany. In: A. Ronen (Hrsg.): The transition from lower to middle Paleolithic and the origin of modern man. British Archaeological Reports 151 (International Series). 1982, S. 165–175.
- ↑ A.J.H. Goodwin: South African stone implement industries S. Afr. J. Sci. 23, 1926, S. 784–788
- ↑ Stephen J. Lycett: Are Victoria West cores “proto-Levallois”? A phylogenetic assessment. Journal of Human Evolution 56, Issue 2, February 2009, S. 175-191 doi:10.1016/j.jhevol.2008.10.001
- ↑ E. Boëda, J. M. Geneste, C. Griggo: A Levallois Point embedded in the vertebra of a wild ass (Equus africanus): hafting, projectiles and Mousterian hunting weapons. In: Antiquity. 73, 1999, S. 394–402.
- ↑ E. Boëda, J. Connan, D. Dessort, S. Muhesen, N. Mercier, H. Valladas, N. Tisnerat: Bitumen as a Hafting Material on Middle Palaeolithic Artefacts. In: Nature. 380, 1996, S. 336–337.
- ↑ Schäfer, Dieter 1993a: Grundzüge der technologischen Entwicklung und Klassifikation vor- jungpaläolithischer Steinartefakte in Mitteleuropa. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 74.
- ↑ Marie Perpére: Apport de la typométrie á la définition des éclats Levallois. In: Búlletin de la Société préhistorique francaise. 83, 1986, S. 115–118.
Literatur
- Eric Boëda: Le concept Levallois: variabilité des méthodes. Monographie du CRA 9. Paris 1994.
- François Bordes: Le débitage Levallois et ses variantes. In: Bulletin de la Société Pré-historique Francaise. 77, 1980, S. 45–49.
- Gerhard Bosinski: Das Mittelpaläolithikum: Steinbearbeitung – Steinwerkzeugformen und Formengruppen – Bearbeitung von Holz, Knochen und Geweih – Schmuck. In: E.-B. Krause (Hrsg.): Die Neandertaler. Feuer im Eis. 250.000 Jahre europäische Geschichte. Gelsenkirchen 1999, S. 74–104.
- Harold L. Dibble, Ofer Bar-Yosef (Hrsg.): The Definition and Interpretation of Levallois Technology. Monographs in World Archaeology, Nr. 23. Prehistory Press, Madison, Wisconsin 1995.
- Philip Van Peer: The Levallois Reduction Strategy. Monographs in World Archaeology, Nr. 13. Madison, 1992.
Weblinks
Wikimedia Foundation.