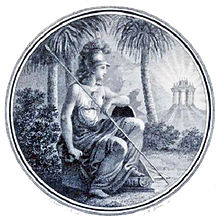- Minerva zu den drei Palmen
-
Minerva zu den drei Palmen ist eine Freimaurerloge in Leipzig.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Am 20. März 1741 wurde in Leipzig eine zunächst namenlose Freimaurerloge gegründet. Sie nahm noch im Gründungsjahr den Namen „Aux trois compas“ (Zu den drei Zirkeln) an und arbeitete dem Zeitgeschmack entsprechend in französischer Sprache. 1746 entstand die deutschsprachige Loge „Minerva“. Beide Logen vereinten sich 1747 zur „Minerva zum Zirkel“. Die Aufnahme einer von Dresden nach Leipzig verlegten Loge „Zu den drei Palmen“ führte schließlich 1772 zu dem Namen „Minerva zu den drei Palmen“.
Mit dem Gründungsjahr 1741 ist die Minerva zehntälteste deutsche Loge. Sie entwickelte sich zu einer der größten Logen Deutschlands. Mitglieder waren angesehen Kaufleute, Universitätsprofessoren, Verleger, Schriftsteller und bildende Künstler. Von der Leipziger Loge gingen weitere Gründungen in Sachsen und Thüringen aus. Gemäß dem freimaurerischen Prinzip der Brüderlichkeit kümmerten sich die Logenmitglieder auch um soziale Belange, wie Linderung der Folgen der Hungerkatastrophe 1770/71, Armenfürsorge und Waisenunterstützung.
Anfangs wurden die Zusammenkünfte der Loge in öffentlichen Wirts- und Kaffeehäusern abgehalten, so z.B. im „Zum goldenen Schiffe“ in der Kleinen Fleischergasse und im „Hotel de Baviere“ in der Petersstraße. Eine solche Lokalität war auch das Wein- und Kaffeehaus des Gastronomen Francesco Venoni in der Schulstraße neben der Pleißenburg, das die Loge 1774 samt Garten als erstes Logenhaus erwarb.
Zur 100-Jahrfeier der Loge schrieb 1841 Albert Lortzing die „Cantate zur Secularfeier der Loge Minerva zu den drei Palmen“ Hört! Des Hammers Ruf ertönet (LoWV 49).
1884–1886 kam es zum völligen Neuaufbau des Logenhauses in der Schulstraße durch Max Bösenberg, nachdem es bereits 1816 eine Erneuerung und Vergrößerung des Logenhauses gegeben hatte.
Auch im 19. Jahrhundert sind soziale Unternehmungen der Loge zu vermerken. 1813 engagierten sich Logenmitglieder bei der Linderung des Leids der Völkerschlacht, und das Logenhaus wurde den Schülern der zerstörten Bürgerschule zur Verfügung gestellt. 1843 erfolgte die Gründung der Begräbnis-Unterstützungskasse, und 1870 gründete Carl Gustav Thiem den Witwen- und Waisen-Pensionsvereins der Loge Minerva. 1896 stifteten Mitglieder der Loge ein namhaftes Kapital und gründeten in Erinnerung an den ehemaligen Meister vom Stuhl Siegfried August Mahlmann die Mahlmann-Stiftung, deren Zinsertrag für wohltätige Zwecke in Leipzig eingesetzt wurde.
Im Jahre 1905 wurde ein neues Logenhaus bezogen. Es entstand an der vom Rathausring abzweigenden Weststraße direkt gegenüber dem Neuen Rathaus hinter dem Pleißemühlgraben. Errichtet wurde es vom Architektenbüro Händel & Franke.[1] Es enthielt unter anderem einen Festsaal und zahlreiche Versammlungsräume.
Unter dem Druck der Nationalsozialisten formte sich die Loge Minerva zu den drei Palmen unter Abkehr von ihren humanitär-freimaurerischen Wurzeln 1933 zum „Christlichen Orden Deutscher Dom“ um. Das war aber nur eine vorübergehende Lösung. 1935 erfolgten die Liquidation des Ordens und die Streichung aus dem Genossenschaftsregister. Die Kontakte zwischen ehemaligen Logenmitgliedern in Vereinen, Stammtischen und im privaten Kreise blieben bis weit in die 1970er Jahre hinein bestehen. Das Logengebäude wurde enteignet und 1937 an das Leipziger Messamt übergeben, das es als „Haus der Nationen“ nutzte.
Bei dem schweren alliierten Luftangriff auf Leipzig am 20. Februar 1944 wurde auch das ehemalige Logenhaus getroffen und zum Teil zerstört. Die Teilruine wurde 1957 abgerissen. Seitdem ist der Platz unbebaut.
Neugründung
Auf Initiative der Loge Friedrich zum Weißen Pferd Hannover wurde 1990 mit den Vorbereitungen zur Wiedergründung der Loge Minerva zu den drei Palmen begonnen, die am 18. November 1990 erfolgte. 1995 konnte das erste eigene Logenhaus in der Ferdinand-Lasalle-Straße bezogen werden. Seit 2000 befindet sich das Logenhaus in der Naunhofer Straße.
Seit 2007 veranstaltet die Loge einmal im Jahr anlässlich der Leipziger Buchmesse die sogenannte „Buchloge“ in den Fundament-„Katakomben“ des Völkerschlachtdenkmals.[2]
Bekannte Mitglieder der Loge
- Johann Friedrich Bause, Kupferstecher
- Karl Biedermann (Politiker), Politiker und Publizist
- Otto Brückwald, Architekt
- Adolf Emil Büchner, Dirigent
- Samuel von Brukenthal, Gouverneur von Siebenbürgen
- Friedrich Burdach, Anatom und Physiologe
- August Dietrich von Marschall auf Burgholzhausen, Jurist
- Bartolomeo Campagnoli, Violinist
- Julius Victor Carus, Zoologe - 1874 bis 1881 Meister vom Stuhl
- Ernst Florens Friedrich Chladni, Physiker und Astronom
- Heinrich Clauren, Schriftsteller
- Johann Carl Friedrich Dauthe, Architekt
- Ferdinand David, Violinvirtuose
- Johann Christian Dolz, Pädagoge
- Johann Georg Eck, Philologe - mehr als 30 Jahre lang Meister vom Stuhl
- Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, Architekt
- Christian Daniel Erhard, Rechtswissenschaftler
- Christian Gottlob Frege, Bankier und Handelsherr
- Samuel Hahnemann, Arzt und Begründer der Homöopathie
- Hans Ernst von Hardenberg, Politiker - 1747 bis 1749 Meister vom Stuhl
- Christian Gottlieb Haubold, Jurist
- Christian von Haugwitz, Diplomat
- Karl Heinrich Heydenreich, Schriftsteller und Philosoph
- Ludwig Ferdinand Huber, Schriftsteller
- Kurt Kluge, Bildhauer und Dichter
- Christian Gottfried Körner, Schriftsteller und Jurist
- Martin Krause, Pianist
- Wilhelm Traugott Krug, Philosoph
- Karl Theodor von Küstner, Theaterintendant
- Magnus Gottfried Lichtwer, Jurist und Fabeldichter
- Gottlob Heinrich von Lindenau, Kreisoberforstmeister
- Hans Lissmann, Tenor
- August Mahlmann, Schriftsteller und Zeitungsverleger - Meister vom Stuhl
- Adolf Eduard Marschner, Komponist
- Oskar Mothes, Architekt
- Wilhelm Müller, Dichter
- Adam Friedrich Oeser, Maler und Bildhauer
- Friedrich Pecht, Maler und Kunstschriftsteller
- Niccolò Peretti, Altist
- Christian August Pohlenz, Gewandhauskapellmeister
- Anton Philipp Reclam, Verleger und Buchhändler
- Gustav von Schlabrendorf, politischer Schriftsteller
- Carl Heinrich August von Schönfels, Rittergutsbesitzer
- Moritz Schreber, Arzt
- Carl Schroeder, Cellist und Dirigent
- Gebhard Werner von der Schulenburg, Diplomat
- Carl Seffner, Bildhauer
- Wilhelm Theodor Seyfferth, Bankier und Eisenbahnpionier
- Christian Ludwig Stieglitz , Jurist und Historiker
- Christian Gottlieb Seydlitz, Physiker und Logiker
- Georg Adam von Starhemberg, Diplomat
- August Cornelius Stockmann, Jurist
- Ludwig Suhl, Bibliothekar
- Carl Christian Philipp Tauchnitz, Verleger
- Johann Amadeus Wendt, Philosoph und Musiktheoretiker
- Fritz Zalisz, Maler
- August Christian Adolf Zestermann, Kunsthistoriker
Einzelnachweise
- ↑ Innere Westvorstadt - Eine historische und städtebauliche Studie. PROLEIPZIG 1998, S. 41
- ↑ Alexander Süß: Leipziger Freimaurer in Wort und Stein. Der Einfluss der Logen auf das Völkerschlachtdenkmal und die Verlagsstadt. Salier Verlag, Leipzig 2009, ISBN 978-3-939611-44-8
Literatur
- Horst Riedel: Stadtlexikon Leipzig von A bis Z. PROLEIPZIG, Leipzig 2005, ISBN 3-936508-03-8, S. 160
Weblinks
Wikimedia Foundation.