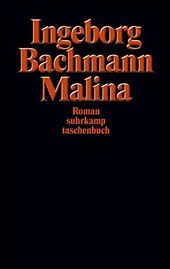- Malina (Roman)
-
Malina ist ein 1971 herausgegebener Roman der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Im Zentrum des Romans steht die (namenlose) Ich-Erzählerin, welche ihre existentielle Situation als Frau und Schriftstellerin bis in die Extremzonen erforscht, und zwar sowohl durch persönliche Reflexion als auch in Dialogform. Sie ist eine Intellektuelle und wohnt in der Ungargasse in Wien; Zeitpunkt der Erzählung ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Struktur des Romans ist dreigliedrig:
Im ersten Kapitel „Glücklich mit Ivan“ erzählt sie von ihrer Beziehung zu Ivan, einem ebenfalls in der Ungargasse wohnhaften gebürtigen Ungarn, der in der Finanzbranche tätig ist. In seiner Nähe will sich die Erzählerin glücklich und geborgen fühlen. Ivan erwidert zwar ihre Liebe, hat aber oftmals nur wenig Zeit (Auslandsreisen) und geht nicht allzu sehr auf ihre ausgeprägte Emotionalität und auf die immer häufiger auftretenden psychischen Probleme ein. Wenn Ivan nicht da ist, unterhält sie sich mit ihrem Mitbewohner Malina, einem ordentlichen, stets die Ruhe bewahrenden Militärhistoriker. Wenn die Protagonistin Malina sucht, ist er immer da. Im Laufe des Romans kristallisiert sich Malina als Alter-Ego der Erzählerin heraus. Oder leidet sie etwa an einer gespaltenen Persönlichkeit und Malina ist ein Teil dieser?
Im zweiten Kapitel „Der dritte Mann“ erfährt man vom Ursprung ihrer Probleme und ihrer übersteigerten Sensibilität; es ist dies der Höhepunkt der Erzählung. In Träumen und tranceartigen Zuständen erinnert sie sich an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, an Gaskammern und Vergewaltigungen. Als personifizierter Schrecken tritt dabei der „Vater“ auf, wobei, wie sie selber erkennt, damit nicht ihr leiblicher Vater gemeint ist, sondern eher die von Männern dominierte Schreckenswelt des Nationalsozialismus an sich. Eine andere mögliche Deutung des Vatermotivs wird von Malina selbst vorgeschlagen; es handele sich hierbei um den inneren Krieg der Ich-Erzählerin. [1]
Im dritten Kapitel „Von letzten Dingen“ versucht sie, im Dialog mit dem immer anständigen, aber wenig nahen Malina ihre Probleme zu überwinden - wobei schnell deutlich wird, dass ein Leben "nach dem Geheimnis", also nachdem sie den Grund für ihre Verzweiflung im zweiten Kapitel freilegen konnte, eigentlich unmöglich ist; dies wird zum Beispiel durch ihre Reflexionen über das Briefgeheimnis am Anfang des Kapitels angedeutet.[2] So handelt das dritte Kapitel von der unausweichlichen Eskalation ihrer Existenz. Die Ich-Erzählerin sieht ein, dass eine Beziehung mit Ivan nicht möglich ist, ja dass wohl überhaupt keine Beziehung für sie mehr möglich ist. Der Sprache und den Normen einer von Männern dominierten Welt hat sie nichts entgegenzuhalten. „Ich habe in Ivan gelebt und ich sterbe in Malina“, stellt sie ernüchtert fest. Der Tod der Ich-Erzählerin wird durch ihr symbolisches Verschwinden in einer Ritze in der Hauswand angedeutet. „Es war Mord.“ Dieser letzte Satz des Romans betrifft auch den Prozess des Schreibens, das sie - ernüchtert - für einen unzureichenden Ersatz für ihre unerfüllte Liebe und als untauglich zur Heilung der durch die Gesellschaft verursachten Wunden hält (Schreiben als schmerzlichste aller Todesarten).
Interpretation
Bachmann selbst bezeichnete ihren Roman „ausdrücklich [als] eine Autobiographie, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Eine geistige, imaginäre Autobiographie. Diese monologische oder Nachtexistenz hat nichts mit der gewöhnlichen Autobiographie zu tun, mit der ein Lebenslauf und Geschichten von irgendwelchen Leuten erzählt werden.“[3] Ganz ähnlich versteht auch Marcel Reich-Ranicki den Roman; er liest ihn als „poetischen Krankheitsbericht, als das Psychogramm eines schweren Leidens.“[4]
Der Roman wurde vielfach als Aufarbeitung der Beziehung Ingeborg Bachmanns mit Max Frisch verstanden und als Antwort auf dessen Roman Mein Name sei Gantenbein gewertet. Er wurde in dieser Hinsicht auch als Schlüsselroman gelesen. Konstanze Fliedl widersprach dieser Lesart in der Hinsicht, dass Bachmann wie Frisch als postmoderne Schriftsteller literarische Identitäten und Lebensgeschichten stets dekonstruiert hätten, dass jedes Ich in ihren Werken stets ein Ergebnis erzählter Geschichten sei.[5]
Rezeption
Ingeborg Bachmann beschwor in einer Albtraum-Sequenz in der Figur des Fremden mit dem schwarzen Mantel Paul Celan herauf. Damit verband sie ihr eigenes Liebesschicksal mit dem jüdischen Schicksal Celans.[6] In dem Band Herzzeit, der die Briefe beider zwischen 1948 und 1967 enthält, enthüllte sie endgültig „die vielfältigen Spuren, die diese Liebe im Werk beider Dichter hinterlassen hat.“[7] Der ebenso mit ihr in einer frühen Lebensphase verbundene Komponist Hans Werner Henze rühmte in einem Telegramm an sie Malina als „DIE ELFTE (Sinfonie) VON MAHLER“.[8]
Der Roman wurde 1990 von Werner Schroeter und Elfriede Jelinek (Drehbuch) mit Isabelle Huppert, Mathieu Carrière und Can Togay in den Hauptrollen verfilmt.
Ausgabe
- Malina. Roman, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1971; Bibliothek Suhrkamp, Band 534, ISBN 3-518-01534-6, 356 Seiten
Literatur
- Jean Firges: Ingeborg Bachmann, „Malina“. Die Zerstörung des weiblichen Ich Sonnenberg, Annweiler 2008, ISBN 393-3264-537 (Interpretation)
- Rezension: Rolf Löchel: Literarische Konstruktion und psychische Bisexualität. J. F. geht anhand von ... „Malina“ der Zerstörung des weiblichen Ichs nach.
Weblinks
- Rezension von Gabriele Wohmann: Nachtwald voller Fragen. In: Der Spiegel, 14/1971.
Einzelnachweise
- ↑ Ingeborg Bachmann: Malina. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1980, S. 193, 247.
- ↑ Ibid, S. 249ff.
- ↑ Ria Endres: Erklär mir, Liebe. Ekstasen der Unmöglichkeit - Zur Dichtung Ingeborg Bachmanns. In: Die Zeit, 2. Oktober 1981.
- ↑ Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben, dtv, Stuttgart 2009, S. 416.
- ↑ Konstanze Fliedl: Deutung und Diskretion. Zum Problem des Biographismus im Fall Bachmann – Frisch. In: Revista de Filología Alemana. Vol. 10 (2002), S. 55–70. (pdf)
- ↑ Zur Affäre Bachmanns mit Celan: Die Liebe, zwangsjackenschön. Von: Helmut Böttiger. In: Die Zeit, o.D.
- ↑ Wer bin ich für Dich? von Peter Hamm. In: Die Zeit, 24. August 2008.
- ↑ »Meine liebe arme kleine Allergrößte« Dokument einer merkwürdigen Liebe: Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze von Peter Hamm in Die Zeit, 24. August 2008.
Prosa
Das Honditschkreuz | Die Fähre | Im Himmel und auf Erden | Das Lächeln der Sphinx | Die Karawane und die Auferstehung | Der Kommandant | Auch ich habe in Arkadien gelebt | Ein Geschäft mit Träumen | Portrait von Anna Maria | Der Schweißer | Der Hinkende | Das dreißigste Jahr (Erzählband) | Malina (Roman) | Der Fall Franza | Simultan (Erzählband)Lyrik
Die gestundete Zeit | Anrufung des großen Bären (mit Reklame) | Letzte, unveröffentlichte Gedichte | Ich weiß keine bessere WeltHörspiele
Ein Geschäft mit Träumen | Die Zikaden | Der gute Gott von Manhattan | Die RadiofamilieLibretti
Ein Monolog des Fürsten Myschkin | Der Prinz von Homburg | Der junge LordEssays
Probleme zeitgenössischer Dichtung | Ein Ort für Zufälle | Römische Reportagen – Eine Wiederentdeckung | Kritische SchriftenÜbersetzungen
Thomas Wolfe: Das Herrschaftshaus | Giuseppe Ungaretti: GedichteBriefwechsel
Ingeborg Bachmann / Hans Werner Henze: Briefe einer Freundschaft | Herzzeit. Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan
Wikimedia Foundation.