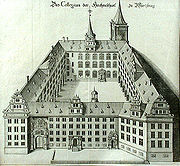- Fürstbistum Würzburg
-
Hochstift Würzburg war die Bezeichnung für das von den Bischöfen von Würzburg in ihrer Eigenschaft als Reichsfürsten beherrschte Territorium des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Ursprung, Hochstift versus Burggrafschaft
Das Würzburger Bistum wurde 741 von Bonifatius gestiftet, der erste Bischof war St. Burkard. Die Bischöfe erwarben im 10. und 11. Jahrhundert die meisten Grafschaften innerhalb ihres Sprengels und die Gerichtsbarkeit über alle Hintersassen. 1168 wurde des Bischöfen von Kaiser Friedrich I. des Privileg "Güldene Freiheit" verliehen, wodurch das Hochstift nach österreichischem Vorbild zum Herzogtum aufstieg. Später nannten sich die Bischöfe außerdem mit zweifelhafter Berechtigung Herzöge in Franken. Eine rechtswirksame, formelle Verleihung ist nicht nachgewiesen. Der allgemeine Gebrauch des Titels "Herzog von Franken" wurde erst im 15. Jahrhundert üblich. Im 13. und 14. Jahrhundert kam es wiederholt zu Streitigkeiten mit den Städten des Stifts, vornehmlich mit Würzburg selbst, so unter Hermann I. von Lobdeburg (1225-54) und Gerhard von Schwarzburg (1372-1400)). Bischof Albrecht II. von Hohenlohe (1345-72) erwarb 1354 die Burggrafschaft Würzburg, welche bisher die Grafen von Henneberg besessen hatten.
Reformation und Gegenreformation, Hexenverfolgung, Kriege
 Umfang der Aufstände während des Bauernkrieges in der Region
Umfang der Aufstände während des Bauernkrieges in der RegionDie Regierungszeit des Bischofs Melchior Zobel von Giebelstadt (1544-58) ist durch die Grumbachschen Händel bekannt. 1582 gründete der Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn eine neue Hochschule, welche nach der Vereinigung Würzburgs mit Bayern den Namen Julius-Maximilians-Universität Würzburg erhielt. Als Mitglied in der katholischen Liga kam es unter Julius Echter zur Durchführung der Gegenreformation im Hochstift Würzburg. In der Folge mussten viele Protestanten auswandern. Die Hexenverfolgungen wurden in großem Umfang wieder aufgenommen. Auch Johann Gottfried von Aschhausen (1617-22) und Philipp Adolf von Ehrenberg (1622-31) waren heftige Gegner der Protestanten; deshalb hatte das Bistum im Dreißigjährigen Krieg stark zu leiden. Der schwedische Kanzler Axel Oxenstierna gab am 20. Juni 1633 dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar die Bistümer Würzburg und Bamberg als Herzogtum Franken zu Lehen; doch konnte sich dieser nach der Niederlage bei Nördlingen nicht darin behaupten, und Würzburg fiel 1634 wieder dem Bischof Franz von Hatzfeld zu. Dieser verwaltete, wie mehrere seiner Nachfolger, zugleich das Bistum Bamberg. Unter der Regierung des Bischofs Franz Ludwig von Erthal (1779-95) erlebte das Hochstift eine letzte Blüte. Georg Karl von Fechenbach war dann der letzte der Würzburger Fürstbischöfe.
Säkularisation
1803 wurde das Hochstift durch den Reichsdeputationshauptschluss säkularisiert und zum größten Teil dem Kurfürstentum Bayern zugeschlagen mit Ausnahme von etwa 826 km², die anderen Fürsten als Entschädigung zugewiesen wurden. Der Fürstbischof erhielt eine jährliche Pension von 60.000 Gulden und überdies 30.000 Gulden als Koadjutor des Bistums Bamberg. Bayern trat im Frieden zu Preßburg gegen Entschädigung das Fürstentum Würzburg 1805 an den ehemaligen Großherzog Ferdinand von Toskana ab, der das ihm 1803 zur Entschädigung überlassene Kurfürstentum Salzburg an Österreich übertrug, wogegen nun Würzburg zum Kurfürstentum erhoben wurde. Am 30. September 1806 trat der Kurfürst dem Rheinbund bei und nahm nun den Titel Großherzog von Würzburg an. Mit der Auflösung des Rheinbundes endigte auch das Großherzogtum Würzburg. Durch Beschluss des Wiener Kongresses erhielt der Großherzog seinen Erbstaat Toskana, Würzburg aber fiel größtenteils an Bayern zurück.
Siehe auch
- Liste der Bischöfe von Würzburg
- Bistum Würzburg
- Hochstift Bamberg
- Liste der Erzbischöfe und Bischöfe von Bamberg
- Liste fränkischer Rittergeschlechter
Weblinks
- Hochstift Würzburg. In: Meyers Konversations-Lexikon. Bd. 16, 4. Aufl. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1885–1892, S. 784
Wikimedia Foundation.