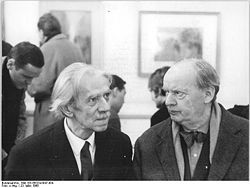- Scharoun
-
Bernhard Hans Henry Scharoun (* 20. September 1893 in Bremen, aufgewachsen in Bremerhaven; † 25. November 1972 in Berlin) war ein deutscher Architekt und einer der bedeutendsten Vertreter der organischen Architektur.
Inhaltsverzeichnis
Leben
1893 bis 1924
Nach dem Abitur in Bremerhaven (1912) studierte Scharoun bis 1914 Architektur an der Technischen Hochschule in Berlin (damals: „Königliche Technische Hochschule zu Berlin“), schloss dieses Studium aber nie ab. Sein erstes Interesse für Architektur zeigte er bereits während seiner Schulzeit. Mit 16 Jahren entstanden erste Entwürfe, mit 18 nahm er erstmals an einem Architektenwettbewerb für die Modernisierung einer Kirche in Bremerhaven teil. 1914 meldete er sich freiwillig zum Dienst im Ersten Weltkrieg. Paul Kruchen, sein Mentor aus Berliner Zeiten brachte ihn in einem Wiederaufbau-Programm für Ostpreußen unter, nach dem Krieg übernahm er 1919 dessen Büro als Freier Architekt in Breslau. Dort und in Insterburg (heute: Tschernjachowsk) realisierte er zahlreiche Projekte und organisierte Kunstausstellungen, wie die erste Ausstellung der expressionistischen Künstlergruppe „Brücke“ in Ostpreußen.
1925 bis 1932
An der Breslauer Akademie für Kunst und Kunstgewerbe erhielt er 1925 eine Professur und unterrichtete bis zu deren Schließung 1932. Bereits 1919 hatte er sich dem expressionistischen Architektenkreis „Gläserne Kette“ von Bruno Taut angeschlossen, 1926 trat er der Architektenvereinigung „Der Ring“ bei. 1927 baute Scharoun ein Wohnhaus in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung, und Ende der zwanziger Jahre zeichnete er für den Bebauungsplan der Großsiedlung Siemensstadt in Berlin verantwortlich. Ausgehend von Hugo Härings Theorie des neuen Bauens vertrat Scharoun einen Architekturbegriff, der sich vom Rationalismus und von vorgefertigten Formschemata löst, um das Gebäude jeweils aus einem besonderen Funktionscharakter heraus zu entwickeln. Dabei spielt die Gestaltung des sozialen Lebensraums eine zentrale Rolle.
1933 bis 1945
Während der Zeit des Nationalsozialismus blieb er in Deutschland, während viele seiner Freunde und Kollegen aus der „Gläsernen Kette“ oder dem „Ring“ ins Ausland gingen. In dieser Zeit baute er nur einige Einfamilienhäuser, darunter das bemerkenswerte Haus Schminke im sächsischen Löbau (1933). Die folgenden Häuser musste er nach außen den politisch bestimmten Bauvorschriften anpassen, im Inneren zeigen sie die typisch scharounschen Raumfolgen. Während des Krieges war er mit der Beseitigung von Fliegerschäden beschäftigt. Seine architektonischen Ideen und Visionen hielt er heimlich auf zahlreichen Aquarellen fest. Mit diesen imaginären Architekturen bereitete er sich geistig auf eine Zeit nach dem Nationalsozialismus vor.
1946 bis 1972
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Alliierten zum Stadtbaurat und Leiter der Abteilung Bau- und Wohnungswesen des Magistrats ernannt. In einer Ausstellung in der zerstörten Ruine des Berliner Stadtschlosses mit dem Titel „Berlin plant — Erster Bericht“, stellt er seine Vorstellungen des Wiederaufbaus von Berlin vor. Alsbald gerät er zwischen die politischen Stühle der sich abzeichnenden Teilung der Stadt.
1946 wird er ordentlicher Professor an der Fakultät für Architektur an der Technischen Hochschule Berlin, Lehrstuhl und Institut für Städtebau.
Karl Bonatz wird 1947 sein Nachfolger als Stadtbaurat.
Nach dem Krieg konnte er in exemplarischen Bauten sein Architekturverständnis verwirklichen, z. B. in der Stuttgarter Hochhausgruppe Romeo und Julia (1954–59), im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lünen (1956–62), in der berühmten Philharmonie in Berlin (1956–63) und in der Volksschule Marl (1960-68), die im Mai 2008 in Scharoun Schule Marl umbenannt wurde. Allen Gebäuden ist der neuartige Zugang zu einer überaus phantasievollen und sozial differenzierten Raumorganisation gemeinsam. Die Schule ist wie eine kleine, kind- und jugendgerechte Stadt geplant, die Hochhausgruppe zeigt eine vielgestaltige Raum- und Funktionsaufteilung. Die Philharmonie schließlich, die international als einer der gelungensten Bauten ihrer Art gilt, ist Scharouns Hauptwerk. Um das Zentrum des Musikpodiums steigen terrassenförmig und unregelmäßig die Ränge der Zuschauer an, die Decke schichtet sich wie ein zeltartiges Firmament über die architektonische Landschaft.
Das Gebäude der Deutschen Botschaft in Brasília (1963–69) bleibt das einzige Gebäude, das er außerhalb Deutschlands baute.
Nach 1972
Einige seiner wichtigsten Bauten wurden erst nach seinem Tod fertiggestellt. Dazu gehören das „Deutsche Schiffahrtsmuseum“ in seiner Heimatstadt Bremerhaven, das Stadttheater in Wolfsburg und die „Staatsbibliothek Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ in Berlin.
Die Erweiterung der Berliner Philharmonie um den Kammermusiksaal, die Staatsbibliothek und das „Staatliche Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz mit Musikinstrumentenmuseum“ entstanden unter der Leitung seines Büropartners Edgar Wisniewski, der das Büro nach Scharouns Tod weiterführte. Die Fassade der Philharmonie wurde in den achtziger Jahren mit einer Verkleidung aus goldeloxierten Aluminiumplatten versehen, ursprünglich war es eine weiß und ocker gestrichene Sichtbetonfassade. Die anfänglichen Planungen Scharouns sahen eine ähnliche Verkleidung vor, die damals aus Kostengründen nicht ausgeführt wurde. Nach der Wiedervereinigung Berlins wurden der östlich des Kulturforums anschließende Potsdamer Platz neu bebaut, weshalb Scharouns städtebaulichen Planungen des angrenzenden Kulturforums zu den Akten gelegt wurden.
Auszeichnungen und Ehrungen
- 1954 Ehrendoktor der Technischen Universität Berlin
- 1954 Fritz-Schumacher-Preis, Hamburg
- 1955 Berliner Kunstpreis
- 1958 Bronzeplakette der Freien Akademie der Künste Hamburg
- 1959 Großes Bundesverdienstkreuz
- 1962 Ehrensenator der Technischen Universität Berlin
- 1964 Großer Preis des Bundes Deutscher Architekten
- 1965 Ehrendoktor der Universität Rom
- 1965 Auguste-Perret-Preis
- 1969 Ehrenbürger von Berlin
- 1970 Erasmus-Preis
Von 1955 bis 1968 war er Präsident der Berliner Akademie der Künste (West), ab 1968 ihr Ehrenpräsident.
Hans Scharoun war ein Gründungsmitglied der Paul-Hindemith-Gesellschaft in Berlin.
Werk
Bauten (Auswahl)
- Einfamilienhaus für die Werkbundausstellung „Die Wohnung“ am Weißenhof, Stuttgart, (1927)
- Junggesellenwohnheim für die Werkbundausstellung „Wohnung und Werkraum“, Breslau, (1929)
- Apartmenthaus am Kaiserdamm, Berlin-Charlottenburg, (1928/29)
- Apartmenthaus am Hohenzollerndamm, Berlin-Wilmersdorf, (1929/30)
- Städtebaulicher Entwurf und Wohnbauten „Siemensstadt“, Berlin-Siemensstadt, (1929–31)
- Einfamilienhaus „Haus Schminke“ Löbau/Sachsen, (1933)[1]
- Einfamilienhaus „Baensch“, Berlin-Spandau, (1935)
- Einfamilienhaus „Hoffmeyer“, Bremerhaven, (1935)
- Einfamilienhaus „Moll“, Berlin-Grunewald, (1936)
- Landhaus in Zermützel (bei Neuruppin), (1937)
- Einfamilienhaus „Mohrmann“, Berlin-Lichtenrade, (1939)
- Wohnhochhausgruppe „Romeo & Julia“, Stuttgart-Zuffenhausen, (1954–59)
- Wohnsiedlung „Charlottenburg-Nord“, Berlin-Charlottenburg-Nord, (1955–60)
- Mädchengymnasium (heute Gesamtschule) „Geschwister-Scholl-Schule“, Lünen, (1956–62)[2]
- Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters, Berlin-Tiergarten, (1957–63)
- Wohnhochhaus „Salute“, Stuttgart-Fasanenhof, (1961–63)
- Haupt- und Grundschule Marl, (1961–66)
- Institute der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Berlin, (1962–70)
- Wohnquartier „Rauher Kapf“ Böblingen, (1965)
- Wohnhochhaus „Orplid“ Böblingen, (1971)
- Botschaftsgebäude der Bundesrepublik Deutschland Brasília/Brasilien, (1964–71)
- Johanneskirche der Christengemeinschaft, Bochum-Altenbochum, (1965–68)[3]
- Stadttheater Wolfsburg, (1965–73)
- Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, (1970–75)
- Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Tiergarten, mit Edgar Wisniewski, (1964–78)
Projekte (Auswahl)
- Wettbewerb Domplatz Prenzlau, 1. Preis, (1919)
- Wettbewerb Deutsches Hygiene-Museum Dresden, (1920)
- Wettbewerb Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße Berlin, (1922)
- Wettbewerb Rathaus Bochum, (1925)
- Wettbewerb Münsterplatz Ulm, (1925)
- Wettbewerb Stadthalle und Ausstellungshallen Bremen, (1928)
- Wettbewerb Liederhalle Stuttgart, 1. Preis, (1949)
- Wettbewerb Amerika-Gedenkbibliothek Berlin, (1951)
- Entwurf Volksschule Darmstadt, (1951) im Rahmen der "Darmstädter Meisterbauten", blieb aber unrealisiert
- Wettbewerb Bebauung der Insel Helgoland, (1952)
- Wettbewerb Staatstheater Kassel, 1. Preis, (1952)
- Wettbewerb Nationaltheater Mannheim, 3. Preis, (1953)
Eigene Texte
- 1925 Antrittsvorlesung an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe Breslau
Nachlass
Der überwiegende Teil des Nachlasses von Scharoun ist in der Abteilung Baukunst der Berliner Akademie der Künste archiviert.[4]
Literatur (Auswahl)
- Bürkle, J. Christoph: „Hans Scharoun und die Moderne — Ideen, Projekte, Theaterbau“, Frankfurt am Main 1986
- Janofske, Eckehard: „Architektur-Räume, Idee und Gestalt bei Hans Scharoun“, Braunschweig 1984
- Jones, Peter Blundell: „Hans Scharoun — Eine Monographie“, Stuttgart 1980
- Jones, Peter Blundell: „Hans Scharoun“, (englisch) London 1995
- Kirschenmann, Jörg C. und Syring, Eberhard: „Hans Scharoun — Außenseiter der Moderne“, Taschen, Köln 2004, ISBN 3-8228-2449-6
- Kirschenmann, Jörg C. und Syring, Eberhard: „Hans Scharoun — Die Forderung des Unvollendeten“, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1993, ISBN 3-421-03048-0
- Pfankuch, Peter (Hrsg.): „Hans Scharoun — Bauten, Entwürfe, Texte“, Schriftenreihe der Akademie der Künste Band 10, Berlin 1974, Neuauflage 1993, ISBN 3-88331-971-6
- Roters, Eberhard: Galerie Ferdinand Möller. - Berlin: Mann, 1984, ISBN 3-7861-1181-2
- Ruby, Andreas und Ilka: Hans Scharoun. Haus Möller. Köln 2004.
- Wendschuh, Achim (Hrsg.): „Hans Scharoun — Zeichnungen, Aquarelle, Texte“, Schriftenreihe der Akademie der Künste Band 22, Berlin 1993, ISBN 3-88331-972-4
- Wisniewski, Edgar: „Die Berliner Philharmonie und ihr Kammermusiksaal. Der Konzertsaal als Zentralraum“, Berlin 1993
- Sohn, Elke: „Zum Begriff der Natur in Stadtkonzepten anhand der Beiträge von Hans Bernhard Reichow, Walter Schwagenscheidt und Hans Scharoun zum Wiederaufbau nach 1945“, Münster: Lit-Verlag 2008, ISBN 978-3-8258-9748-2
Ebenfalls im "Glockengarten" steht ein wenig bekanntes architektonisches Kleinod, der einzige Sakralbau vom weltbekannten Architekten Hans Scharoun. Gebaut zwischen 1966-68 steht die Johanneskirche in Altenbochum seit 1999 unter Denkmalschutz. Schon während seiner Studienzeit hat Hans Scharoun erste Entwürfe für Sakralbauten gezeichnet. Erst viele Jahre später wurde dann durch eine zufällige Querverbindung zwischen der Familie Schmincke und der Johannesgemeinde in Bochum aus erneuten Entwürfen eine Realität. Bei der Innenraumgestaltung wirkten auch weitere Mitglieder des Bauhauses durch Gemälde und die Altarleuchter mit. Auf dem Gelände des alten Pappelhofes steht nun seit mehr als 40 Jahren dieses einzigartige Bauwerk. Der Zahn der Zeit hat auch hier genagt und erfordert nun eine grundlegende Restauration. Hierzu hat sich die "Initiative Scharounkirche" als unselbständige Stiftung unter der Treuhand als Schwester der GLS Bank Bochum gegründet. Als Auftakt der groß angelegten Spendenaktion zum Erhalt dieses besonderen Bauwerkes der Moderne findet am 10.Mai 09 um 11:45 Uhr die Eröffnung einer Fotoausstellung des jungen, bereits international ausgezeichneten Fotografen Jonas Holthaus statt. Die Scharoun-Kirche kann jeden Sonntag ab 11:45 Uhr oder nach Anmeldung besichtigt werden.
Weblinks
- Webseite über Hans Scharoun bei archINFORM
- Informationen zu Hans Scharoun | Haus Schminke-Website
- Literatur von und über Hans Scharoun im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Weissenhofsiedlung | Multimedia-Portal
Quellen
- ↑ Webseite über das Haus Schminke
- ↑ Das Gebäude auf der Webseite der Geschwister-Scholl-Schule Lünen
- ↑ Johanneskirche in einer Architekturdatenbank aus Bochum
- ↑ http://deu.archinform.net/arch/31232.htm?
Personendaten NAME Scharoun, Hans ALTERNATIVNAMEN Scharoun, Hans Bernhard KURZBESCHREIBUNG deutscher Architekt GEBURTSDATUM 20. September 1893 GEBURTSORT Bremen STERBEDATUM 25. November 1972 STERBEORT Berlin
Wikimedia Foundation.