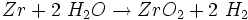- Nukleare Sicherheit
-
Konzepte zur Sicherheit von Kernkraftwerken sollen Gefährdungen durch den Betrieb dieser großtechnischen Anlagen verhindern, vermeiden und reduzieren.
Aufgrund der bei Nukleartechnik auftretender Risiken wie hohe Energiedichte, mögliche Proliferation und generell hohes Gefahrenpotential radioaktiver Stoffe und mangelnde unmittelbare sinnliche Wahrnehmbarkeit von Radioaktivität gehören kerntechnische Anlagen zu denen am intensivsten auf mögliche Risiken untersuchten und extern kontrollierten großtechnischen Anlagen. Im Gegensatz zu anderen Großtechniken (Chemie, Stahl, Bergbau) wurde in der durch staatliche, insbesondere militärische Großprojekte dominierten Technikgeschichte der Kernkraft versucht, nicht nach dem Konzept Versuch und Irrtum verschiedene Sicherheitskonzepte am Markt zu testen. Stattdessen wurde angestrebt, mögliche Großrisiken über den gesamten Prozessablauf planerisch vorherzusehen, von vornherein auszuschließen und Störfälle beherrschbar und begrenzt ablaufen zu lassen.
Joachim Radkau bemängelt einen Mangel an öffentlicher Diskussion der unterschiedlichen kerntechnische Entwicklungen (und der verschiedenen Sicherheitsphilosophien und Konzepte) über die gesamte Technikgeschichte der Kernkraft in Westdeutschland hinweg.
Bei der Diskussion um die Sicherheit von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik ist ihm zufolge eine Früh- und Spätphase zu unterscheiden. Anfangs bestand ein öffentlicher Konsens über die Technologie, branchenintern jedoch erhebliche Unzulänglichkeiten in der technischen und ökonomischen Entwicklung der Kernenergie, unter anderem ein unkoordiniertes Nebeneinander zu vieler Reaktorlinien und übereilte Entwicklung und Inbetriebnahme einzelner Typen. Mitte der 70er Jahre hatte sich die technische Entwicklung stabilisiert, der öffentliche Konsens wurde aber zunehmend aufgekündigt.
Problem und Lösungsansatz
Das Risiko von Kernkraftwerken besteht im Wesentlichen im möglichen Austritt radioaktiver Stoffe in die Umgebung. Ein solcher Austritt kommt zum Einen durch die radioaktiven Emissionen im normalen Betrieb zustande. Zum Anderen kann er sich als Folge von kleineren oder größeren Störfällen bzw. Unfällen ergeben. Die Radioaktivitätsfreisetzung im Normalbetrieb ist so klein, dass ihr Anteil im Vergleich zur natürlichen Strahlenbelastung (im Wesentlichen kosmische Strahlung und terrestrische Strahlung) vernachlässigbar ist und sich darauf zurückzuführende gesundheitliche Schäden nicht beobachten ließen bzw. nach heutigem Wissensstand solche Beobachtungen nicht zu erwarten sind. Im Folgenden wird daher nur auf die Störfallsicherheit von Kernkraftwerken eingegangen.
Einen Austritt radioaktiver Stoffe möglichst zu verhindern, war von Anfang an das Ziel der sicherheitstechnischen Entwicklung von Kernkraftwerken. Dabei geht man von der Erkenntnis aus, dass ein gravierendes Versagen von technischen Einrichtungen nicht rein zufällig eintritt, sondern aufgrund einer Kette von Ursachen und Wirkungen. Sind diese Wirkungsketten bekannt, können sie gezielt unterbrochen werden. Wird ein solches Unterbrechen mehrfach und mit voneinander unabhängigen Maßnahmen vorgesehen, kann man insgesamt eine sehr hohe Sicherheit erreichen, da Fehler in einzelnen Schritten durch Funktionieren der anderen Schritte aufgefangen werden können. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Fehler auf ein Versagen von Komponenten oder Systemen („technische Fehler“) oder auf Fehlhandlungen von Menschen („Bedienungsfehler“, „menschliche Fehler“, auch „organisatorische Fehler“) zurückzuführen sind. Man spricht von einem „mehrstufigen, fehlerverzeihenden Sicherheitskonzept“.
Dieser Ansatz wird bei Kernkraftwerken grundsätzlich weltweit verfolgt. Wie erfolgreich er ist, hängt allerdings ganz wesentlich davon ab, wie er umgesetzt wird. Im Folgenden wird das systematische Vorgehen bei modernen, westlichen Leichtwasserreaktoren beschrieben. Vor allem bei Reaktoren aus dem früheren Ostblock liegen zum Teil deutlich andere Verhältnisse vor.
Mehrstufiges, fehlerverzeihendes Sicherheitskonzept
Ausgangspunkt des Sicherheitskonzeptes der westlichen Leichtwasserreaktoren ist der Einschluss der radioaktiven Materialien in mehrfachen, einander umschließenden Barrieren (Mehrbarrierenkonzept) und die Gewährleistung der ausreichenden Integrität und Funktion der Barrieren durch ein System gestaffelter Maßnahmen (Konzept der Sicherheitsebenen). Dabei kommt immer wieder der gleiche Grundgedanke zum Tragen: Versagen die Schutzmaßnahmen in einer Ebene, soll dieses Versagen durch Schutzmaßnahmen auf der nächsten Ebene aufgefangen werden. Nur wenn die Maßnahmen auf allen Ebenen versagen, wird die (planmäßige) Rückhaltefunktion einer Barriere beeinträchtigt oder aufgehoben. Und wenn eine Barriere versagt, aus welchem Grund auch immer, soll die Störung durch die anderen Barrieren aufgefangen werden. Nur wenn alle Barrieren versagen, kann es zum Austritt größerer Mengen radioaktiver Stoffe kommen.
Abgerundet wird dieses Konzept durch vier ergänzende Maßnahmen:
- Den Grundsatz „Qualität trotz Mehrstufigkeit“: Für jede einzelne Barriere und Sicherheitsebene gibt es detaillierte Festlegungen der Funktionen und Aufgaben sowie der erforderlichen Qualität (einschließlich z. B. geforderter Sicherheitszuschläge bei der Auslegung von Systemen und Anlageteilen). Kompromisse gegenüber diesen Anforderungen infolge des Vorhandenseins anderen Barrieren oder Ebenen sind – unabhängig von der Qualität dort - unzulässig.
- Den Grundsatz „Fehler unterstellen trotz Qualität“: Trotz generell hoher Qualität wird grundsätzlich ein (technisches oder menschliches) Versagen unterstellt und entsprechende Auffangmaßnahmen werden vorgesehen.
- Die Konstruktion des Reaktorkernes erfolgt so, dass sich ein selbststabilisierendes Verhalten der Kettenreaktion und damit der Leistungserzeugung ergibt (negative Rückkopplung, „inhärente Stabilität“; diese dient insbesondere auch zur Entkopplung der einzelnen Sicherheitsebenen).
- Schließlich wird das gesamte Sicherheitskonzept noch durch probabilistische Sicherheitsanalysen auf Wirksamkeit und Ausgewogenheit überprüft.
In westlichen Kernkraftwerken wurden in bisher rund 10.000 Reaktorbetriebsjahren insgesamt über 40.000 Milliarden kWh Strom erzeugt. Dabei ist es zu keinem Unfall mit gravierenden radiologischen Auswirkungen auf die Bevölkerung in der (näheren und weiteren) Umgebung gekommen. Das zugrunde gelegte Sicherheitskonzept hat sich als äußerst robust erwiesen.
Siehe: Störfälle in europäischen Atomanlagen
Das Barrierenkonzept
In westlichen Leichtwasserreaktoren dienen sechs Barrieren zum Zurückhalten der radioaktiven Stoffe:
- Das Kristallgitter des Brennstoffes [innerhalb 6]
- Bei den Kernspaltungen in einem Reaktor entstehen die Spaltprodukte gewissermaßen als Fremdatome im Kristallgitter des Urandioxids. Solange dieses intakt bleibt, werden sie (außer den gasförmigen Spaltprodukten, das sind aber nur ca. 5 %) sehr zuverlässig im Kristallgitter zurückgehalten.
- Die gasdicht verschweißten Hüllrohre der Brennstäbe [6]
- Das Urandioxid wird zu Tabletten gepresst, in etwa fingerdicke Rohre aus Zircaloy (Festigkeitseigenschaften ähnlich wie Stahl) eingefüllt und diese Rohre werden dann oben und unten gasdicht verschweißt. Solange alle Schweißnähte dicht sind und auch sonst kein Loch in einem Hüllrohr auftritt, halten die Hüllrohre alle Spaltprodukte in ihrem Inneren sicher zurück. Allerdings entstehen auch im Regelbetrieb trotz hoher Neutronenpermeabilität strukturelle Veränderungen durch Strahleneinwirkung und Korrosion. Somit erhält ein kleiner Teil der Hüllrohre Risse, die zum Austritt der gasförmigen Spaltprodukte führen können. Dies sind i. d. R. Isotope (Jod, Xenon, Krypton) mit mittleren Halbwertzeiten.
- Der Reaktordruckbehälter [5] mit anschließenden Rohrleitungen [8]
- Der Reaktordruckbehälter besteht aus einem ca. 20 bis 25 cm dicken Stahl. Zusammen mit den anschließenden Rohrleitungen bildet er ein geschlossenes Kühlsystem, in dem auch eventuell aus den Hüllrohren austretende Spaltprodukte eingeschlossen sind.
- Der thermische Schild [4]
- Dieser dient vor allem der Abschirmung von Direktstrahlung aus dem Reaktorkern. Da er keine vollkommen geschlossene Konstruktion aufweist, kann er Spaltprodukte nur teilweise zurückhalten.
- Der Sicherheitsbehälter [2]
- Dieses gasdichte und druckfeste „Containment“ aus ca. 4 cm dickem Stahl (manchmal auch aus Spannbeton) ist so ausgelegt, dass es im Falle eines Lecks im Reaktorkühlkreis das gesamte austretende Wasser/Dampf-Gemisch mit allen darin eventuell enthaltenen Spaltprodukten sicher aufnehmen kann.
- Die umschließende Stahlbetonhülle [1]
- Der gesamte Sicherheitsbehälter wird von einer etwa 1,5 bis 2 m dicken Stahlbetonhülle umgeben, die vor allem Einwirkungen von außen – wie z. B. Zerstörungen durch einen Flugzeugabsturz – verhindern soll, aber natürlich auch radioaktive Materialien in seinem Inneren zurückhalten kann.
In anderen Reaktoren, insbesondere in solchen des ehemaligen Ostblocks, sind z. T. weniger und qualitativ schlechtere Barrieren vorhanden.
Daneben gibt es noch die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:
- Wasserbecken [3]
- Wasser dient der Abschirmung von Radioaktivität, innerhalb des Reaktordruckgefäßes als Moderator. Die unteren Wasserbecken (Pumpensümpfe) sind im Normalfall leer, sie sammeln im Falle eines Lecks das austretende Wasser und erlauben eine Wiedereinspeisung in den Kreislauf, um eine Austrocknung des Reaktors zu vermeiden. (Keine Barriere, sondern eine Sicherheitsmaßnahme)
- Gefilterte Druckentlastung [9]
- Bei einem gravierenden Unfall kann durch verdampfendes Wasser ein unzulässiger Druck im Sicherheitsbehälter entstehen. Dieser Druck kann kontrolliert und gefiltert durch das Druckentlastungssystem [9] (Wallmann-Ventil) abgelassen werden.
- Wasserstoffabbau
- Durch verschiedene Oxidationsreaktionen kann bei hohen Temperaturen, die infolge eines Störfalls mit Kernschmelzen entstehen, gasförmiger Wasserstoff freigesetzt werden. Beispielsweise reagiert die Zirconium-Legierung der Brennstabrohre ab einer Temperatur von 900 °C nach folgender chemischer Reaktionsgleichung mit Wasser:
-
- Hierbei entsteht neben Zirconiumoxid und gasförmigem Wasserstoff infolge der stark exothermen Reaktion Wärmeenergie von 576 kJ/mol H2. Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit GmbH ermittelte in einer Studie, dass im Fall einer Kernschmelze bei einem Zirconiuminventar eines Druckwasserreaktors (Containmentvolumen ca. 70.000 m3) von 20 Tonnen Zirconium innerhalb von 6 Stunden ca. 5.000 m3 Wasserstoff entstehen. Zusammen mit Sauerstoff würde der Wasserstoff als Knallgas ab einer Konzentration von etwa 4 Volumenprozent explosionsfähig werden. Bei Druckwasser-Reaktoren besteht wegen ihres kleinen Volumens zusätzlich die Gefahr, dass der zusätzliche Druck durch den Wasserstoff den Reaktorbehälter überlastet. Bis zum Unfall mit Kernschmelze in Three Mile Island 1979 wurde die Zirconium-Reaktion nicht in den Szenarien möglicher Unfälle berücksichtigt. Nachdem der Graphitbrand beim Unfall von Tschernobyl 1986 eindrücklich auf die mögliche Bedeutung von chemischen Reaktionen als Folge der Kernschmelze hinwies, wurden in Deutschland Einrichtungen verpflichtend vorgeschrieben, welche die Entstehung eines zündfähigen Wasserstoff-Sauerstoffgemisches verhindern. Im Containment von Druckwasserreaktoren wurden daraufhin an exponierten Stellen katalytische Rekombinatoren installiert, an deren Oberfläche das Knallgas (auch weit unterhalb der Explosionsgrenze) zu Wasser reagiert. Der Sicherheitsbehälter von Siedewasserreaktoren wird im Normalbetrieb mit Stickstoff geflutet, so dass bei einem Unfall zwar freier Wasserstoff entsteht, für die Entstehung von Knallgas aber der Sauerstoff fehlt.
- Ein weiterer Weg, wie bei Kernreaktoren Wasserstoff entsteht, ist die Spaltung von Wasser durch ionisierende Strahlung. Dieser Radiolyse genannte Prozess produziert direkt Knallgas. Die Geschwindigkeit mit der das Knallgas erzeugt wird, ist gering im Vergleich zu den Gasmengen bei der Zirconiumreaktion. Selbst im Falle einer Kernschmelze besteht nicht die Gefahr, dass der Reaktordruckbehälter in kurzer Zeit mit einem zündfähigen Radiolyse-Gas gefüllt wird. Da die Reaktion auch während des normalen Betriebs abläuft, kann sich das Knallgas allerdings über längere Zeit ansammeln und dann durch ionisierende Strahlung gezündet werden. Daher sind auch an exponierten Stellen in den Systemen des Primärkreislaufs solche oben schon erwähnten katalytischen Rekombinatoren installiert, an deren Oberfläche das Knallgas zu Wasser reagiert. Trotz dieser Vorkehrungen ist im Kernkraftwerk Brunsbüttel im November 2001 ein an den Reaktordeckel angeschlossenes Rohr durch eine Knallgas-Explosion zerstört worden.
Das Konzept der Sicherheitsebenen
In modernen deutschen Kernkraftwerken gibt es vier Sicherheitsebenen: Die erste Ebene entspricht dem Normalbetrieb des Kraftwerkes. Hier sollen Störungen möglichst vermieden werden. Trotzdem wird unterstellt, dass Störungen auftreten. In der zweiten Ebene, dem „anomalen Betrieb“, wird dann das Ziel verfolgt, diese Störungen einzudämmen und zu verhindern, dass sie sich zu Störfällen ausweiten. Auch hier wird wieder systematisch unterstellt, dass dieses Ziel nicht erreicht wird und in der dritten Ebene, der Ebene der Störfallbeherrschung, werden Störfälle durch sehr zuverlässige eigene Sicherheitssysteme möglichst aufgefangen. Doch auch hier wird systematisch ein Versagen unterstellt und in der vierten Ebene wird mit „anlageninternen Notfallschutzmaßnahmen“ versucht, die Auswirkungen des Störfalles möglichst auf die Anlage selbst zu beschränken und einschneidende Maßnahmen in der Umgebung (insbesondere Evakuierung) nicht notwendig werden zu lassen.
Nachwärmeabfuhr
Ein möglicher Mechanismus, der zum Versagen mehrerer Barrieren führen kann, ist eine Überhitzung des Reaktorkerns bis zum Schmelzen der Brennelemente (Kernschmelzunfall). Dadurch würden die vier erstgenannten Barrieren zerstört und längerfristig möglicherweise auch die beiden restlichen Barrieren. Gegen eine solche Überhitzung sind entsprechende Kühleinrichtungen erforderlich. Da ein Kernkraftwerk auch nach dem Abschalten durch den Zerfall der angesammelten radioaktiven Spaltprodukte noch Wärme produziert (so genannte Nachzerfallswärme; unmittelbar nach dem Abschalten sind das noch etwa 5 % der Nennleistung, nach 10 Stunden sind es noch ca. 0,5 % der Nennleistung, auch nach Monaten sind es noch nennenswerte Wärmemengen), müssen diese Kühleinrichtungen langfristig sicher funktionieren (Nachwärmeabfuhr). Auch diese Kühleinrichtungen sind mehrfach vorhanden und nur wenn hinreichend viele von ihnen versagen (und auch nicht durch Notfallmaßnahmen ersetzt werden können), kann es zu einer Kernschmelze kommen. Ein größerer radiologischer Unfall ist nur im Falle einer Kernschmelze möglich. Anderenfalls können höchstens relativ kleine Mengen radioaktiver Substanzen in die Umgebung entweichen.
Kühlmittelverlust
Ein Fehler, der jedenfalls prinzipiell zur Beeinträchtigung der Nachwärmeabfuhr und damit zu einer Kernschmelze führen kann, ist ein Wasserverlust durch Austreten von Wasser aus einem Leck, z. B. durch Bruch einer Rohrleitung. Durch ausreichende Nachspeisung muss ein solches Leck sicher beherrscht werden. In der Frühzeit der Kernenergienutzung ging man davon aus, dass das schlimmste zu berücksichtigende Ereignis zur Gefährdung der Nachwärmeabfuhr der doppelendige Bruch der größten Rohrleitung sei. Ein solches Leck musste unterstellt werden (größter anzunehmender Unfall, GAU) und dagegen musste das Kernkraftwerk ausgelegt werden (Auslegungsstörfall). Ein GAU war also definitionsgemäß ein Ereignis, das noch beherrscht werden sollte, d. h. bei dessen Eintreten schwerwiegende Auswirkungen auf die Umgebung durch die Auslegung der Anlage vermieden werden.
Siehe auch Kühlmittelverluststörfall
Auslegungsstörfälle und Auslegungsprinzipien für Sicherheitseinrichtungen
Wenn dieser GAU beherrscht wird, so meinte man damals, würden auch alle anderen Störfälle sicher beherrscht werden. Heute weiß man, dass das nicht immer so sein muss und an Stelle des einen Auslegungsstörfalles ist ein ganzes Spektrum von Auslegungsstörfällen getreten, deren Beherrschung einzeln nachgewiesen werden muss. In Deutschland sind die Anforderungen in den so genannten Sicherheitskriterien und Störfall-Leitlinien detailliert geregelt. Dabei ist auch festgelegt, dass die Beherrschung stets auch dann gewährleistet sein muss, wenn eine Störfallbeherrschungsteileinrichtung durch einen zusätzlichen, vom auslösenden Störereignis unabhängigen (technischen oder menschlichen) Fehler funktionsunfähig sein sollte (Einzelfehlerkriterium) und wenn eine zweite Störfallbeherrschungsteileinrichtung gerade in Reparatur sein sollte (Reparaturkriterium). Diese beiden Kriterien stellen eine Präzisierung des Redundanzprinzips dar, demzufolge stets mehr Einrichtungen zur Störfallbeherrschung vorhanden sein müssen, als eigentlich benötigt werden. Damit sollen Funktionsausfälle abgedeckt werden. Außerdem müssen die Störfallbeherrschungseinrichtungen von den Betriebseinrichtungen getrennt und untereinander entmascht sein, d. h. sie müssen voneinander unabhängig (ohne gemeinsame Komponenten) und räumlich oder baulich getrennt angeordnet sein. Und, um mögliche Ausfälle aus gleicher Ursache zu vermeiden, müssen sie möglichst diversitär ausgeführt sein (Diversitätsprinzip). Zusammen mit anderen Anforderungen, wie Fail Safe Prinzip (ein Fehler wirkt sich möglichst in die sichere Richtung aus) und Automatisierung (Vermeiden von Personalhandlungen unter Zeitdruck), wird insgesamt ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit der Störfallbeherrschung erreicht.
Einwirkungen von außen
Natürlich bezieht sich Sicherheit nicht nur auf Ereignisse, die innerhalb der Anlage verursacht werden, sondern auch auf mögliche Einwirkungen von außen. Moderne deutsche Kernkraftwerke sind z. B. unter anderem gegen Erdbeben, Explosionsdruckwellen, Hochwasser, Flugzeugabsturz und terroristische Angriffe geschützt. Die Auslegungsanforderungen werden grundsätzlich standortspezifisch festgelegt und ihre Einhaltung wird in den Genehmigungsverfahren nachgewiesen. Speziell zum Flugzeugabsturz haben sich die Auslegungsanforderungen entsprechend der Weiterentwicklung der Flugzeuge im Laufe der Jahrzehnte verschärft. Bei älteren Kernkraftwerken wurden flugzeugabsturzgesicherte Notsteuerstellen (auch Notstandssysteme genannt) nachgerüstet, von denen die Anlage im Falle einer Zerstörung der Warte sicher abgefahren werden kann. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center wurde die Frage gestellt, ob die vorhandene Auslegung auch ausreichend gegen absichtlich zum Absturz gebrachte Großraumflugzeuge ist. Bei den neuen Anlagen, die gegen den Absturz schnell fliegender Militärmaschinen ausgelegt sind, wurde dies bestätigt. Auch bei älteren Anlagen (einschließlich der nachgerüsteten Notsteuerstellen) sind schwerwiegende Beschädigungen sehr unwahrscheinlich. Zur Zeit wird überlegt, ob die Sicherheit durch Vernebelungsanlagen, die bei Gefahr eines gezielten Flugzeugabsturzes aktiviert werden, weiter verbessert werden kann.
Schutzzielkonzept
Für ein Kernkraftwerk lassen sich folgende vier Schutzziele definieren:
- Das oberste Schutzziel ist der Einschluss der Radioaktivität. Große radiologische Unfälle sind nur bei hinreichender Verletzung dieses Schutzzieles möglich. Solange die erste Barriere (Kristallgitter des Brennstoffes) erhalten bleibt, wird der weit überwiegende Teil der Radioaktivität sicher zurückgehalten und das Schutzziel ist ausreichend erfüllt. Durch das Vorhandensein der anderen Barrieren bedeutet eine Zerstörung des Kristallgitters aber noch nicht zwangsweise die Freisetzung großer Radioaktivitätsmengen.
- Eine Zerstörung des Kristallgitters in größerem Umfang ist technisch nur durch Schmelzen des Reaktorkerns (oder eines erheblichen Teils davon) möglich. Solange die Brennelemente ausreichend gekühlt werden, ist ein Schmelzen nicht möglich. Daraus ergibt sich das zweite Schutzziel: Kühlung der Brennelemente.
- Da die sicherheitstechnischen Kühlsysteme nur für die Abfuhr der Nachwärme (und nicht für den Leistungsbetrieb) ausgelegt sind, muss der Reaktor immer sicher abschaltbar sein. Daraus lässt sich als drittes Schutzziel ableiten: Kontrolle der Reaktivität (gemeint ist die Unterbrechung der Kettenreaktion von Kernspaltungen).
- Falls die Abschaltungsmöglichkeit des Reaktors aus nicht vorhersehbaren Gründen ausfällt, muss dennoch sichergestellt sein, dass die Kettenreaktion nicht unkontrolliert eskaliert. Dies wird durch die Sicherstellung eines negativen Reaktivitätskoeffizienten gewährleistet, der bewirkt, dass bei Erwärmung des spaltbaren Materials die Reaktivität automatisch sinkt. Ein negativer Reaktivitätskoeffizient kann durch die Reaktorkonstruktion sowie durch die Gestaltung der Brennelemente sichergestellt werden. Darum legen die EURATOM-Verträge fest, dass nur Kernreaktoren mit negativem Reaktivitätskoeffizienten zum Betrieb zugelassen werden dürfen. (Für den Reaktor von Tschernobyl galt diese Bedingung nicht!)
Werden diese vier Schutzziele hinreichend eingehalten, sind große radiologische Unfälle nicht möglich. Umgekehrt bedeutet ihre Verletzung noch nicht zwangsweise einen Unfall, doch ist ein solcher dann nicht mehr zuverlässig ausschließbar. Die Bedeutung dieser Schutzziele wurde insbesondere nach dem Störfall im Kernkraftwerk Harrisburg erkannt. Seitdem werden in westlichen Kernkraftwerken diese Schutzziele unabhängig vom vorliegenden Anlagenzustand und vom auslösenden Ereignis einer Störung gezielt überwacht. Bei Gefährdung der Schutzziele werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Dadurch werden auch solche Fälle abgedeckt, bei denen die Betriebsmannschaft die vorliegende Störung nicht erkennt oder falsch einschätzt.
Das Restrisiko
Das beschriebene Sicherheitskonzept ermöglicht ein sehr hohes Ausmaß an Sicherheit sowohl gegen technisches Versagen als auch gegen menschliche Fehler. Aber Null im mathematischen Sinne kann das Risiko nie werden, da ein gleichzeitiges Versagen noch so vieler Sicherheitsvorkehrungen niemals ganz ausgeschlossen werden kann. Das bei einer gewählten Auslegung verbleibende Risiko bezeichnet man als „Restrisiko“. Bei modernen westlichen Kernkraftwerken ist es sehr viel kleiner als zahlreiche andere Risiken des täglichen Lebens. Diese Risikobewertung wird in der Öffentlichkeit häufig anders vorgenommen, wird aber von den meisten Fachleuten getragen. Hier weicht die überwiegende wissenschaftliche Ansicht deutlich von der veröffentlichten Meinung ab.
Betriebliche Störungen
Kernkraftwerke sind komplexe und große Anlagen. Ein modernes Kernkraftwerk z. B. versorgt etwa eine Million Menschen mit dem benötigten Strom. Wie in jeder Technik, ist es auch hier unvermeidbar, dass beim Betrieb immer wieder Störungen auftreten. Anfänglich waren es noch sehr viele Störungen, durch den Lerneffekt wurden es dann immer weniger, aber auch heute noch treten sie auf und auch in der Zukunft werden sie unvermeidbar sein. Aus ihrem Auftreten alleine kann man noch nichts über die Sicherheit einer Anlage aussagen. Das kann man erst aus einer sorgfältigen Analyse der Störungen und ihrer Begleitumstände. Diese sorgfältige Analyse zu betreiben, ist ein wesentlicher Teil der laufenden Überwachung und Verbesserung der Sicherheit. Die Kernenergie unterscheidet sich diesbezüglich grundsätzlich nicht von anderen risikobehafteten Techniken.
Harrisburg und Tschernobyl
In der Geschichte der Kernenergienutzung ragen die beiden Ereignisse von Three Mile Island (Harrisburg) und Tschernobyl heraus.
Dabei hat Three Mile Island die Effektivität des Konzeptes mit gestaffelten und voneinander unabhängigen Barrieren und mehrfachen Einrichtungen zum Schutz dieser Barrieren bestätigt: Das Ereignis war so nicht vorgedacht gewesen. Durch eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände wurden die ersten vier Barrieren zerstört. Die restlichen beiden (Sicherheitsbehälter und Stahlbetonhülle) aber hielten Stand und verhinderten schwerwiegende Auswirkungen nach außen. Radioaktivität ist trotzdem in die Umgebung gelangt: Eine Rohrleitung des Wasserreinigungssystems aus dem Sicherheitsbehälter heraus ist von einer Automatik geöffnet worden. Außerdem hat die Abgasbehandlung des Hilfsanlagengebäudes versagt und in ihr sind (störfallbedingt) Leckagen aufgetreten.
Der Unfall in Tschernobyl verlief nicht nur ganz anders, sondern es bestanden auch ganz andere Voraussetzungen:
Zum einen wies die Konstruktion des Reaktors (Typ RBMK) gravierende Mängel auf:
- Der Reaktor enthielt 1700 t brennbaren Graphits, dessen Brand mit keinem Mittel gelöscht werden konnte. Andere Reaktoren enthalten keine brennbaren Materialien.
- Die Barrieren gegen den Austritt radioaktiver Substanzen waren weniger und qualitativ schlechter, insbesondere aber fehlten die beiden letztgenannten Barrieren Sicherheitsbehälter und Stahlbetonhülle praktisch vollkommen.
- Regelstäbe, die durch Hineinfahren in den Reaktorkern die Reaktivität im Reaktor senken sollen, wirkten beim Hineinfahren kurzzeitig reaktivitätssteigernd.
- Dampfblasenbildung in Folge mangelnder Kühlung führte zu einer erhöhten Reaktivität (positiver Dampfblasenkoeffizient).
- Es war möglich, den Reaktor in einen Zustand zu versetzen, in dem der Reaktor prompt kritisch wird.
Zum Anderen passierten menschliche und organisatorische Fehler:
- Der Reaktor wurde zur Zeit des Störfalles für einen Versuch außerhalb der Versuchsbeschreibung betrieben.
- Die Sicherheitseinrichtungen wurden zum Teil abgeschaltet/überbrückt, um dieses Experiment zu ermöglichen.
- Die Betriebsvorschriften wurden vom Betriebspersonal nicht eingehalten.
- Auf das Betriebspersonal wurde Druck vom zuständigen Ministerium ausgeübt.
Der gleiche Unfall wie in Tschernobyl kann in einem westlichen Kernkraftwerk bauartbedingt ausgeschlossen werden.
Sicherheitstechnische Weiterentwicklung
Die Sicherheit von Kernkraftwerken ist keine Naturkonstante. Sie ist abhängig davon, wie ein Kernkraftwerk konstruiert, gebaut und betrieben wird. Weltweit ist die Sicherheit von Kernkraftwerken seit ihrer Einführung 1956 durch Erfahrungszuwachs und Nachrüstungen deutlich gestiegen und diese Entwicklung hält noch weiter an. Seit 1994 wird in Deutschland darüber hinaus durch das geänderte Atomgesetz auch gefordert, dass bei neu zu errichtenden Kernkraftwerken auch über die Auslegung hinausgehende Störfälle (Kernschmelzunfälle) soweit eingedämmt werden müssen, dass sich ihre Auswirkungen im Wesentlichen auf das Kraftwerksgelände beschränken und in der Umgebung keine gravierenden Maßnahmen zur Risikobegrenzung (Evakuierungen) notwendig sind. Die neue deutsch/französische Gemeinschaftsentwicklung „European Pressurized Water Reactor“ (EPR) erfüllt diese Bedingungen. Ein solches Kraftwerk wird zur Zeit in Finnland gebaut und in Frankreich ist ein Bau beschlossen worden.
Absolute Sicherheit im mathematischen Sinn kann aber grundsätzlich nirgends, also auch nicht bei Kernkraftwerken erreicht werden. Es kann nur das Risiko als Produkt aus Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und seiner Folgen im Eintrittsfalle immer weiter gesenkt werden. Das ist bisher geschehen und wird auch weiter geschehen. Dabei werden sowohl die Sicherheit vorhandener Kernkraftwerke laufend verbessert als auch verbesserte Konstruktionen für neue Kernkraftwerke entwickelt.
Ein Ende im laufenden Verbesserungsprozess ist nicht abzusehen. Seit Mai 2001 arbeiten mittlerweile 11 Länder in einem breit angelegten Gemeinschaftsprojekt unter Führung der USA im Rahmen des „Generation IV International Forum for Advanced Nuclear Technology (GIF)“ an weiterentwickelten Reaktorkonzepten. Mit erheblichem Aufwand werden insgesamt 6 verschiedene Reaktorkonzepte mit dem Ziel einer deutlich weiter erhöhten Sicherheit und verbesserten Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig verbesserter Brennstoffausnutzung und erhöhter Proliferationssicherheit verfolgt, außerdem werden die Möglichkeiten der nuklearen Wasserstofferzeugung untersucht. Zwei dieser Konzepte sollen 2015 und die restlichen vier sollen 2020 die Baureife für Demonstrationsanlagen erreichen. Ein kommerzieller Einsatz könnte dann vielleicht 10 Jahre später erfolgen. Aber auch bei einem Erfolg dieses Programms wird das Risiko sich nicht auf Null drücken lassen. Die Risiken werden zwar (voraussichtlich) nochmals kleiner sein, aber die Notwendigkeit der Risikoabwägung wird auch dann noch bestehen.
Nachrüstungsmaßnahmen deutscher KKW gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse
Neben den oben genannten Weiterentwicklungen für KKW-Neubauten wurden auch die bestehenden Anlagen sicherheitstechnisch nachgerüstet, um auch auslegungsüberschreitende Ereignisse beherrschen zu können. Zu den prominentesten Maßnahmen zählen – neben diversen anderen, kleineren Maßnahmen - insbesondere folgende:
Inertisierung des Sicherheitsbehälters bei SWR
Hier wird während des Reaktorbetriebs der Sicherheitsbehälter mit reinem Stickstoff geflutet, um bei einem Unfall mit Wasserstoff-Freisetzung eine Knallgasexplosion zu verhindern (Sauerstoffmangel).
Gefilterte Druckentlastung des Containments bei DWR
Dabei kann im Fall eines Druckanstiegs im Containment (in diesem Fall das Reaktorgebäude) der Druck über einen Filter abgelassen werden, um ein Übersteigen des Auslegungsdrucks (und damit ein Bersten) zu vermeiden. Durch die Filter wird die Freisetzung von Radioaktivität in einem solchen Fall minimiert. Umgangssprachlich wird die hierfür verwendete Vorrichtung nach dem seinerzeit amtierenden Bundesumweltminister Walter Wallmann als Wallmann-Ventil bezeichnet.
Töpfer-Kerzen
Darunter versteht man den Einbau von katalytischen Rekombinatoren zum Wasserstoffabbau. Diese sollen das Wasserstoffgas noch vor dem Erreichen der Explosionsgrenze durch Rekombination (katalytisches „Verbrennen“ von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser ohne Funken oder Flamme) abbauen. Das System wird umgangssprachlich nach dem früheren Umweltminister Klaus Töpfer als Töpfer-Kerze bezeichnet.
Alternativ wurden auch Systeme zum Zünden des Wasserstoffs unterhalb der Explosionsgrenze entwickelt, was ebenfalls zu einem „sanften“ Abbau des Wasserstoff (Deflagration) führt.
Statistische Daten
Gemessene Statistiken zur Sicherheit von KKWs sind nur teilweise vorhanden, nämlich für kleinere Unfälle, die in der Vergangenheit tatsächlich eingetreten sind. Unfälle mit Radioaktivitätsaustritt und großen Todeszahlen kamen dagegen in der westlichen Hemisphäre in der Vergangenheit nicht vor. So erscheint die Anzahl der sofortigen Todesopfer in OECD-Staaten von 1969 bis 2000 pro GWJahr durch KKWs in einer Statistik des schweizerischen Paul-Scherrer-Instituts (PSI) für Nuklear- und Reaktorforschung [1] als „Null“. Beim GWJahr handelt es sich dabei nicht um eine Zeiteinheit, sondern um die Energiemenge, die innerhalb 1 Jahres von einem theoretischen Kraftwerk mit 1 Gigawatt bei beliebiger Energiequelle, also nicht nur Atomenergie, produziert wird. Ein durchschnittliches westeuropäisches AKW besitzt 4 Druckwasserreaktoren (DWR) mit je etwa 1.000 MW (1 GW) Leistung, und produziert somit 4 GWJahr pro Kalenderjahr, oder 1 GWJahr per 3 Monate. Laut dem PSI ist also im Durchschnitt zumindest innerhalb von 3 Monaten noch kein Mensch aufgrund der Inbetriebnahme eines AKWs sofort verstorben.
Die genannte PSI-Studie listet allerdings für die gleiche erzeugte Atomenergiemenge 26.000 sofortige Todesopfer allein in China von 1994 bis 1999 auf, und weist darauf hin, daß es bei Atomenergie weniger auf die sofortigen Todesopfer, als vielmehr auf die zahlreicheren Todesfolgen aufgrund von Langzeitschäden (Strahlenkrankheit, Leukämie, sonstige Krebsarten, etc.) ankomme. Die Studie listet für die Todesfälle aufgrund von Langzeitfolgen durch AKWs allein die Katastrophe von Tschernobyl, und schätzt diese auf etwa 10.000 bis 100.000 Todesfälle, die bis heute unmittelbar auf die Langzeitfolgen von Tschernobyl zurückzuführen seien, ohne die Folgen von Harrisburg, Sellafield, Majak oder anderen AKW-Unfällen mit Radioaktivitätsaustritt zu berücksichtigen (s. auch die Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen, die sich allein mit Fällen von Radioaktivitätsaustritten befasst).
Um repräsentative statistische Aussagen über einen gewissen Unfalltyp (etwa GAU) zu machen, müsste jedoch dieser Unfalltyp mindestens einmal eingetreten sein. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls einer bestimmten Größe lässt sich daher nicht aus der Vergangenheit ablesen. Stattdessen wird diese in probabilistischen Sicherheitsanalysen (zumindest als Obergrenze) berechnet:
Probabilistische Sicherheitsanalysen
In so genannten Probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) wird versucht, das Risiko von Kernkraftwerken zu quantifizieren. Dabei wird mit sehr großem Aufwand ermittelt, mit welcher Zuverlässigkeit sich angenommene Störungen („auslösende Ereignisse“) mit den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen „planmäßig beherrschen“ lassen. Für Absolutaussagen zur Sicherheit insgesamt sind die Ergebnisse wenig geeignet, da ein Überschreiten des „planmäßigen Beherrschens“ noch nichts über die dann eintretenden Folgen aussagt. Durch vorhandene Auslegungsreserven (unter anderem entsprechend den Sicherheitszuschlägen in der konventionellen Technik) werden bei geringfügigen Überschreitungen meist gar keine Folgen auftreten, doch wird dieser Bereich in den üblichen PSA nicht untersucht, er kann daher auch nicht quantifiziert werden. Eine PSA liefert insofern stets nur eine obere Grenze für das verbleibende Risiko, beziffert aber nicht das Risiko selbst. Das muss bei einer Bewertung der Ergebnisse stets mit bedacht werden. Wofür sich PSA aber sehr gut bewährt haben, sind vergleichende Sicherheitsbetrachtungen im Sinne von Erkennen von möglichen Schwachstellen und Bewerten von geplanten Änderungen. Dadurch haben PSA zu vielen kleinen Verbesserungsschritten beigetragen und sind heute ein unverzichtbares Instrument der Weiterentwicklung der Sicherheit.
Statistischer Vergleich zu anderen Energiequellen
Die Zahl von unfallbedingten Todesfällen pro erzeugter Energiemenge ist für Kernkraft deutlich geringer als für andere Arten der Elektrizitätserzeugung. Eine Beispielrechnung für das schweizerische Kernkraftwerk Mühleberg ergibt 0,02 Todesfälle pro GWJahr. Diese Zahl schließt sowohl unmittelbare als auch latente Todesfälle ein. Zum Vergleich: die unmittelbaren Todesfälle durch andere Energiequellen waren 1969-1996: 0,1 Todesfälle pro GWJahr für Gasturbinenkraftwerke, 0,3 für Kohlekraftwerke und 0,9 für Wasserkraft.[1]
Würde der Bedarf an elektrischer Energie in Deutschland (derzeit etwa 66 GWJahre pro Jahr) also allein durch Kernkraftwerke gedeckt, wären im Langzeitdurchschnitt 1,3 Todesfälle pro Jahr zu beklagen. Würde er andererseits allein durch Gasturbinenkraftwerke gedeckt, wären es 6,6 Todesfälle pro Jahr, bei Kohlekraftwerken rd. 20 jährlich. Für erneuerbare Energiequellen wäre diese Zahl aufgrund ihrer arbeitsintensiven und dezentralen Struktur noch höher.
Die zugrundeliegende Studie (Hirschberg u. a. (1998): Severe accidents in the energy sector) des bereits weiter oben zitierten Paul-Scherrer-Instituts befaßt sich in puncto AKWs (S. 137-182) allerdings hauptsächlich mit den geschätzten anfallenden Kosten für die überhaupt mögliche Schadensbegrenzung bei schlimmstmöglichen fiktiven Unfallszenarien in AKWs mit höchsten Sicherheitsstandards (die in der Studie auch in westlichen Ländern als selten erfüllt bezeichnet werden) und bei maximaler Entfernung von menschlichen Siedlungen, nicht etwa mit einem einzelnen AKW oder den tatsächlichen Auswirkungen einer solchen Katastrophe wie etwa konkreten Todeszahlen oder dem Ausmaß menschlicher wie Umweltschäden; die Ergebnisse lassen sich daher auch so deuten, dass bei AKW-Unfällen trotz erheblicher Belastung und Schädigungen weniger getan werden kann.
Allerdings werden unterschiedliche Unfälle von der Öffentlichkeit unterschiedlich wahrgenommen.
Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls
Nach der Deutschen Risikostudie der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) von 1989 ist für eines der deutschen Kernkraftwerke alle 33.000 Betriebsjahre mit einem schweren Unfall zu rechnen. Werden 17 laufende Kernkraftwerke in Deutschland (Stand 2005) und 30 Betriebsjahre berücksichtigt, liegt demnach die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Unfall in Deutschland innerhalb von 30 Jahren bei etwa 1,5 %. Die Befristung der Regellaufzeiten auf rund 30 Jahre erfolgte allerdings erst durch den 2002 beschlossenen Atomkonsens; der älteste heute noch betriebene deutsche Reaktor Biblis A wird seit 34 Jahren genutzt, wurde aber 2009 abgeschaltet. Der älteste 2002 noch arbeitende Reaktor war der 1968 in Betrieb genommene Reaktor Obrigheim, der 2005 nach 37 Jahren stillgelegt wurde.
Allerdings bleiben in dieser Studie mehrere Aspekte unberücksichtigt. Sabotagemaßnahmen oder panikbedingte Fehlentscheidungen des Personals wie in Harrisburg fließen nicht in die Berechnungen ein. Auch bleiben unerwartete, da bis dahin übersehene physikalische Phänomene unberücksichtigt. Ein Beispiel dafür ist die massive Produktion von Wasserstoff aus einer chemischen Reaktion zwischen Wasserdampf und dem überhitzten Metall überhitzter Brennstäbe bei Kühlmittelverlust. Bis zum Unfall in Three Mile Island waren weltweit keine Einrichtungen vorgesehen, die die Vermischung dieses Wasserstoffs mit Umgebungsluft zu explosionsfähigem Knallgas verhindern.
Die GRS-Studie von 1989 wurde von Atomexperten des Darmstädter Öko-Instituts dahingehend kritisiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls hier als zu niedrig eingestuft wird.
Andere Studien, insbesondere neuere der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), kommen wiederum zu niedrigeren Unfallswahrscheinlichkeiten, da nachgerüstete Kernkraftwerke und erst recht neue Modelle über weiter gehende Sicherheitssysteme verfügen. So wird das Risiko eines Unfalls mit Reaktorschaden für den EPR mit 1 pro 1.000.000 Betriebsjahre angegeben (Quelle: Bundesamt für Energie, Bern).
Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Radioaktivität
Klagen gegen Kraftwerksbetreiber wegen gehäufter Krankheitsfälle nach bekannt gewordenen Unfällen sowie die nachgewiesene Häufung bestimmter Krebsarten rund um bestimmte, für Störfälle bekannte Kraftwerke (auch in Deutschland) treten immer wieder auf. Im normalen Betrieb entweichen kleine Mengen radioaktiven Materials vom Kernkraftwerk in die Umwelt. Dieses Material umfasst radioaktive Edelgase (z. B. Krypton-85) sowie das instabile Wasserstoffisotop Tritium, deren Entweichen gemessen wird und strengen Auflagen unterliegt.[2] Trotzdem stehen sie im Verdacht, durch Aufnahme in den menschlichen Organismus krebsauslösend zu wirken. Dies zeigte sich bei einer epidemiologischen Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz im Jahr 2007. Die Leukämie-Rate bei Kindern war in der Nähe (5 km) von Kernkraftwerken signifikant erhöht.[3] [4][5] Die genaue Ursache für diese erhöhte Leukämierate in der Umgebung von Kernkraftwerken ist bisher nicht bekannt - siehe auch Leukämie in der Elbmarsch; der November 2004 veröffentlichte Abschlussbericht der eingesetzten Expertenkommission, der die möglichen Zusammenhänge zwischen dem Elbmarschleukämiecluster und dem dortigen AKW untersuchte, endete aufgrund zahlreicher Behinderungen ihrer Arbeit mit den Worten: "Wir haben das Vertrauen in diese Landesregierung verloren." Untersuchungen des Deutschen Ärzteblatts (1992) und des British Medical Journal (1995) haben in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen ebenfalls erhöhte Leukämieraten bei Kindern festgestellt - ebenso aber auch generell in der Umgebung größerer Baustellen im ländlichen Bereich (siehe auch Nocebo-Effekt). Letzteres deutet also darauf hin, dass es an Standorten, die u. a. auch für Kernkraftwerke geeignet sind, Faktoren gibt, die von sich aus bereits ein erhöhtes Erkrankungsrisiko mit sich bringen; dabei wird vermutet, dass das erhöhte Auftreten der speziellen Krebsarten sich daraus erklären lässt, dass diese ansteckend seien und die Krankheitserreger durch Arbeitsmigration von Bauarbeiterfamilien eingeschleppt würden.[6][7]
Ein wichtiger Bestandteil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um Krankheitsfälle aufgrund von AKWs betrifft auch die Entnahme von Bodenproben in deren unmittelbaren Umgebung zur Messung der örtlichen Kontaminierungsabweichung mit radioaktivem Material, besonders mit sog. PAC-Kügelchen aus Plutonium, Americium und Curium. Eine erhöhte Kontaminierung wird dabei ebenfalls wiederholt festgestellt (s. etwa Leukämiecluster Elbmarsch); es herrscht unter den sich gegenüberstehenden wissenschaftlichen Fraktionen allerdings Uneinigkeit darüber, ob diese erhöhte Kontamination in der unmittelbaren Umgebung der Kraftwerke tatsächlich von den AKWs herrühren kann, da dort solche Kügelchen nicht verwendet werden, oder doch eher auf Kernwaffentests oder die Katastrophe von Tschernobyl zurückzuführen ist. Aus Tschernobyl entwich zwar nachweislich eine große Menge an Plutonium, jedoch fand sich im dortigen graphitmoderierten RBMK-Reaktortyp keinerlei Americium oder Curium, die aufgrund des Reaktordesigns auch nicht während der Havarie oder aufgrund natürlicher Zerfallsprozesse danach entstanden sein konnten.
Wesentliches Problem des statistischen (epidemiologischen) Nachweises solcher Effekte ist, dass die unterstellten Einflüsse (z. B. Krebserkrankung durch Strahlenbelastung) durch die geringen Fallzahlen und die geringen Strahlendosen nicht mit hinreichender Sicherheit von den sonstigen Einflüssen mit der gleichen Wirkung (z. B. Rauchen, Stress, Ernährung, Bevölkerungsmigration, etc.) und der natürlichen Eintrittswahrscheinlichkeit getrennt werden können. Ebenso problematisch ist die Zuweisung eines bestimmten Todesfalls oder einer bestimmten Krebserkrankung zu einer bestimmten Ursache.
Eine erhöhte Leukämierate bei Kindern gilt statistisch nicht als Beweis einer potentiellen Gefahr, da diese Kinder nicht beweisbar direkt durch den Betrieb des Kraftwerkes erkrankt sind, und da Erkrankungen (im Gegensatz zu Todesfällen) nicht in allen Statistiken zum Thema erfasst werden.
Ein Betrieb von Kohlekraftwerken setzt ebenfalls radioaktiver Strahlung frei. Die in der Kohle gebundenen natürlichen radioaktiven Zerfallsprodukte werden durch das Verbrennen der Kohle freigesetzt und über die heißen Abgase weiträumig verteilt. Eine Untersuchung des Leukämierisikos im Umkreis von Kohlekraftwerken wurde bisher nicht durchgeführt.
Siehe auch
- Hochtemperaturreaktor
- Internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse
- Kerntechnischer Ausschuss
- Liste der Kernkraftwerke
- Störfälle in deutschen Atomanlagen (ohne bestätigten Radioaktivitätsaustritt; 13 Fälle)
- Störfälle in europäischen Atomanlagen (ohne bestätigten Radioaktivitätsaustritt; über 30)
- Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen (mit bestätigtem signifikanten Radioaktivitätsaustritt; etwa 40, davon 27 in westlichen Ländern)
- Zentrale Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen
Literatur
Hirschberg et al: Severe Accidents in the Energy Sector, Paul Scherrer Institut, 1998. S. 241f
Einzelnachweise
- ↑ Hirschberg et al, „Severe Accidents in the Energy Sector“ 1998. S. 241f., Paul Scherrer Institut
- ↑ Bundesamt für Strahlenschutz: Emissionsüberwachung bei Atomkraftwerken (pdf)
- ↑ Deutsches Kinderkrebsregister
- ↑ taz.de: Experten uneins über AKW-Gefahr (11.12.2007)
- ↑ Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken - im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz 2007 - pdf 13 MB
- ↑ Kinlen LJ et.al., Childhood leukaemia and non-Hodgkin`s lymphoma near large rural construction sites, with a comparison with Sellafield nuclear site., in BMJ, 310/1995, S.763–7
- ↑ Michaelis J, Krebserkrankungen im Kindesalter in der Umgebung westdeutscher kerntechnischer Anlagen., in Deutsches Ärzteblatt, 89/1992, S.C-1386-90
Weblinks
- "Herausforderung Kernenergie im 21. Jahrhundert", Tagung am 06.Juli 2006 an der Ruhr-Uni Bochum
- THE INTERNATIONAL CHERNOBYL PROJECT
- Technischer Bericht
- Aktueller Lagebericht Gamma-Ortsdosisleistung - Radiologische Lage in der Bundesrepublik Deutschland: Gamma-Ortsdosisleistung - Normalpegel (ODL Deutschland des BFS)
Wikimedia Foundation.