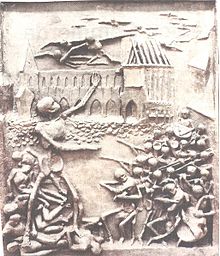- Barfüßerkirche (Erfurt)
-
Die Barfüßerkirche gehörte bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1944 zu den bedeutendsten Kirchenbauten Erfurts und zu den schönsten Bettelordenskirchen Deutschlands. Sie steht im Stadtzentrum westlich der Schlösserbrücke am rechten Ufer des Breitstroms, einem Seitenarm der Gera.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Im Jahr 1224 ließen sich in Erfurt als erste Bettelmönche die Franziskaner nieder, sie wurden auch Barfüßer genannt. Sieben Jahre später war die erste Klosterkirche des Bettelordens errichtet. Nach dem Stadtbrand von 1291 wurde mit einem Neubau begonnen, dessen Chor 1316 geweiht wurde. Die Bautätigkeiten am Langhaus der dreischiffigen Pfeilerbasilika dauerten bis Anfang des 15. Jahrhunderts, der Turmbau war um 1400 beendet. Die hochgotische Kirche mit einem langen durchgehenden Satteldach gehörte zu den größten Kirchen der Stadt und war in den folgenden Jahrhunderten im Stadtbild ein markanter Punkt.
Im Zuge der Reformation wurde das Gotteshaus im Jahr 1525 Gemeindekirche der evangelischen Barfüßergemeinde. Vier Jahre später 1529 predigte am 11. Oktober Martin Luther in ihr. Die Klostergebäude im Norden der Kirche wurden in der Schwedenzeit von 1641−1648 abgetragen und zum Bau einer Bastion der Stadtbefestigung verwendet. Ein Blitzschlag im Jahr 1838 beschädigte das Langhaus und machte von 1842 bis 1852 eine umfangreiche Restaurierung notwendig.
Im Zweiten Weltkrieg wurden das bewegliche Kunstgut der Kirche und die wertvollen Farbverglasungen von 1230/40 durch Auslagerung gesichert. Am 27. November 1944, in der Nacht zum Totensonntag um zwei Uhr, wurde die Kirche, wie auch das benachbarte Wohngebiet und das Pfarrhaus, beim Angriff von mehreren britischen Mosquitobombern durch eine Luftmine getroffen.[1] Das Langhaus des Meisterwerks franziskanischer Architektur wurde zerstört, der Hohe Chor schwer beschädigt. Die Aufräumungsarbeiten und die Bergung von wertvollen Architekturteilen folgten ab 1945. Das teilzerstörte Gestühl der Kirche wurde im Notwinter 1945 von der benachbarten Bevölkerung verfeuert. Zu Christi Himmelfahrt 1957 wurde erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert, und zwar im seit 1950 instandgesetzten Hohen Chor, der durch eine Wand vom zerstörten Kirchenschiff abgetrennt worden war. Die Farbverglasungen von 1230/40 waren wieder eingefügt worden, ebenso der restaurierte Hochaltar von 1445.[2] Die Reste des Langhauses konnten nur statisch-konstruktiv gesichert werden. Aufgrund sinkender Mitgliederzahl vereinigten sich 1977 in der Erfurter Innenstadt die Barfüßergemeinde sowie die Predigergemeinde, und die Kirche wurde an die Stadt übergeben. Nach weiteren Sanierungen des Chors wurde der Kirchenbau 1983 Außenstelle des Angermuseums für mittelalterliche Kunst. Seit 1989 erfolgen dringend notwendige weitere Sicherungsmaßnahmen.
Nach 1990 wurde eine Gedenktafel an der Außenwand aus der DDR-Zeit entfernt, die auf die Zerstörung „durch einen angloamerikanischen Luftangriff“ hingewiesen hatte. Seit etwa dem Jahr 2000 finden im Inneren der Kirchenruine Theateraufführungen statt, auch Lustspiele.
Im Jahr 2007 bildete sich eine Arbeitsgruppe „Barfüßerkirche“, die sich zum Ziel gesteckt hat, das Bewusstsein der Erfurter Bevölkerung für dieses Denkmal nationaler Bedeutung zu stärken und somit den Erhalt der Ruine langfristig zu sichern, beziehungsweise die Kirche eines Tages wieder aufgebaut zu haben.[3]. Die Arbeitsgruppe erhielt im November 2011 aus Bundesmitteln die Summe von 100.000 Euro für Sanierungsarbeiten im Rahmen des Denkmalpflege-Programms "National wertvolle Kulturdenkmäler". [4]
Ausstattung
Der polygonale Chor besitzt dreizehn hohe Fenster, in denen teilweise farbige Glasscheiben eingebaut sind, die aus den Jahren 1230 bis 1235 stammen und schon in der ersten Barfüßerkirche vorhanden waren. Die Scheiben zeigen Szenen aus der Passion Christi und dem Leben des Franz von Assisi.
Der Flügelaltar aus dem Jahr 1445 gehört zu den bedeutendsten Schnitzaltären Erfurts. Bemerkenswert sind auch die die Grabsteine der Cinna von Vargula aus dem Jahr 1370 und des Weihbischofs Albert von Beichlingen von 1371.
Literatur
- Otto Arend-Mai:Die evangelischen Kirchen in Erfurt. Wartburg-Verlag, Jena 1989, ISBN 3-374-00936-0.
- Uwe Vetter: Die Barfüßerkirche. Denkschrift zur 60. Wiederkehr ihrer Zerstörung am 26./27.11.1944. Hrsg. Gemeindekirchenrat der Ev. Predigergemeinde, Erfurt 2004
Einzelnachweise
- ↑ Helmut Wolf:Erfurt im Luftkrieg 1939 - 1945. Schriften des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt e.V. Band 4, 2005. ISBN 3-931743-89-6
- ↑ Rudolf Zießler in „Schicksale deutscher Baudenkmale im zweiten Weltkrieg“. Hrsg. Götz Eckardt, Henschel-Verlag Berlin 1978. Band 2, S. 477-478
- ↑ barfüsserkirche.de
- ↑ Freude über Geld. Thüringische Landeszeitung, 18. November 2011
Weblinks
Ägidienkirche | Albanikirche (†) | Allerheiligenkirche | Andreaskirche | Augustinerkirche | Barfüßerkirche | Bartholomäuskirche (T) | Benediktikirche (†) | Brunnenkirche | Dom St. Marien | Gangolfikirche (†) | Georgskirche (T) | Gotthardtkirche (†) | Hospitalkirche | Johanneskirche (T) | Kartäuserkirche | Kaufmannskirche | Leonhardskirche (†) | Lorenzkirche | Magdalenenkapelle | Äußere Martinikirche | Innere Martinikirche (†) | Matthiaskirche (†) | Michaeliskirche | Moritzkirche (†) | Neuwerkskirche | Nikolaikirche (T) | Paulskirche (T) | Peterskirche | Predigerkirche | Reglerkirche | Schottenkirche | Servatiuskirche (†) | Severikirche | Alte Thomaskirche (†) | Ursulinenkirche | Vitikirche (†) | Wigbertikirche
(†): Kirche nicht mehr vorhanden | (T): nur noch der Kirchturm vorhanden
Wikimedia Foundation.