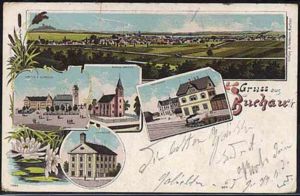- Kappel (Bad Buchau)
-
Wappen Deutschlandkarte 
48.06629.61592Koordinaten: 48° 4′ N, 9° 37′ OBasisdaten Bundesland: Baden-Württemberg Regierungsbezirk: Tübingen Landkreis: Biberach Höhe: 592 m ü. NN Fläche: 23,77 km² Einwohner: 4056 (31. Dez. 2007)[1] Bevölkerungsdichte: 171 Einwohner je km² Postleitzahl: 88422 Vorwahl: 07582 Kfz-Kennzeichen: BC Gemeindeschlüssel: 08 4 26 013 Adresse der Stadtverwaltung: Marktplatz 2
88422 Bad BuchauWebpräsenz: Bürgermeister: Peter Diesch Lage der Stadt Bad Buchau im Landkreis Biberach 
Bad Buchau ist eine Kurstadt westlich von Biberach an der Riß, direkt am Federsee. Als Moorheilbad und Mineralheilbad (Thermalbad) ist die kleine Stadt bei den Touristen bekannt.
Inhaltsverzeichnis
Geografie
Stadtgliederung
Zu Bad Buchau gehören die drei Stadtteile Ottobeurer Hof, Kappel und Henauhof.
Geschichte
Archäologen erforschen seit mehr als 120 Jahren die Umgebung der Stadt und des Federsees. Es gibt zahlreiche Funde von eiszeitlichen Rentierjägern und Pfahlbauern der Steinzeit bis zur Keltenzeit. Hier fand man die ältesten Holzräder Europas.
In der späten Bronzezeit lag rund 2 km südöstlich der heutigen Stadt eine vom Wasser umgebene, befestigte Siedlung, die heute so genannte „Wasserburg“.
Um 700 n. Chr. liegt am Nordwestrand der buchenbestandenen Insel ein alemannischer Adelshof.
Das Frauenkloster Buchau wurde um 770 durch das fränkische Grafenpaar Warin und Adelindis gegründet. Unabhängig von diesem Stift, ja sogar in jahrhundertelanger gegenseitiger Abneigung einander zugetan, entwickelte sich die Bürgerschaft Buchau. Im Jahre 1014 (oder 1022) wird eine Münz- und Marktstätte Buchau erwähnt. Vom 13. Jahrhundert bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches war Buchau eine der flächenmäßig kleinsten Freien Reichsstädte, dank seiner Insellage auch ohne Mauern und Türme. 1787 und 1808 wurde der Wasserspiegel des Federsees abgesenkt und damit ging Buchau dieser Insellage verlustig.
In der Folge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 fielen sowohl die Stadt als auch das Stift Buchau an die Fürsten von Thurn und Taxis, als Entschädigung für links des Rheins verlorene Einkünfte aus ihrem Postmonopol. 1806 übernahm das Königreich Württemberg die Oberherrschaft und schlug Buchau dem Oberamt Riedlingen zu, das 1934/1938 aufgelöst wurde.
Von 1896 bis 1917 erhielt die Stadt Anschluss an die Bahn-Hauptstrecken mit der Federseebahn, einer Schmalspurbahn von Schussenried über Buchau nach Riedlingen. Sie wurde allerdings 1969 vollständig stillgelegt. Die Lokomotive am ehemaligen Bahnhof erinnert an diese Zeit.
1935 kam es zu einem stärkeren Erdbeben, das im Ortsteil Kappel schwere Schäden anrichtete.
1963 erhielt Buchau den Titel „Bad“ als Moorheilbad.
Wappen
Die Stadt Buchau am Federsee führt das nachfolgend beschriebene Stadtwappen (siehe rechts oben): Auf silbernem Hintergrund eine bewurzelte grüne Buche, deren Stamm mit einem schwimmenden Fisch (Barsch) beheftet ist. Das Wappen macht mit der Buche den Stadtnamen “redend”. Der Fisch weist auf die Lage am Federsee hin. Auf Siegeln ist das Wappen seit dem Jahr 1390 nachzuweisen.
Religionen
Seit 1382 wohnten in Buchau Juden, ab 1570 wird in der Stadt eine jüdische Gemeinde genannt, die in der Judengasse lokalisiert wird. Der jüdische Friedhof ist heute noch erhalten. Im 18. Jahrhundert baut die Gemeinde eine Synagoge, Anfang des 19. Jahrhunderts eine neue größere mit Turm und Glockenspiel. 1838 wohnen in Buchau 736 Juden, ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung. Am 9. November 1938 wurde die Kappeler Synagoge während der Reichspogromnacht zerstört. In Buchau scheiterte in der Pogromnacht der Versuch einer SA-Standarte aus Ochsenhausen, die den Befehl von der SA -Brigada aus Ulm erhielten, weil der damalige Bürgermeister Hugo Öchsle der Feuerwehr befehlswidrig angewiesen hatte, die brennende Synagoge zu löschen. Doch bereits am Folgetag, in der Nacht vom 10. auf den 11. November um 3.00 Uhr, wurde auf Geheiß des SA-Brigadeführers aus Ulm die Aktion wiederholt. Dabei beteiligt waren acht bis zehn Angehörige des SA-Sturms Ochsenhausen und ein NSDAP-Trupp aus Saulgau. Die Folgen waren verheerend: die Synagoge wurde zerstört und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Diese wurden etwa eine Woche später durch Ulmer Pioniere gesprengt. In der Folgezeit wurden die 257 Juden[2] deportiert bzw. in die Emigration getrieben.[3][4]
Die Eltern von Albert Einstein wohnten bis kurz vor seiner Geburt in Buchau.
Politik
Gemeinderat
Bei der Kommunalwahl am 13. Juni 2004 ergab sich folgende Sitzverteilung:
Wirtschaft und Infrastruktur
Ansässige Unternehmen
- Franz Kessler GmbH (Hersteller von Spindelsystemen, Asynchron- und Synchronmotoren)
Bildungseinrichtungen
Bad Buchau verfügt über ein Progymnasium sowie eine Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule.
Freizeit- und Sportanlagen
Der oberschwäbische Kurort bietet seinen Kurgästen zahlreiche Therapieanwendungen, Moorbäder und ein großes Thermalbad (Adelindis-Therme) mit Saunalandschaft. Das Thermalwasser kommt aus einer Tiefe von 795 m mit einer Temperatur von 47,5 °C.
Das NABU-Naturschutzzentrum Federsee betreut das Moor, ist Anlaufstelle für Besucher und Weiterbildungszentrum.
Der Federsee ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet. Auf 3300 Hektar Moor leben 265 Vogelarten, davon 107 Brutvogelarten. Hauptattraktion sind der Federseesteg und der Wackelwald. Der Wackelwald wächst auf einem ehemaligen Weiher, der zur Eisgewinnung im Winter diente. Durch den moorigen Untergrund wird die Oberfläche dort nur durch eine Wurzelschicht zusammengehalten, deshalb gibt der Boden bei jedem Schritt elastisch nach und durch leichtes Hüpfen kann man auch die Bäume zum Wackeln bringen.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bad Buchau liegt an der Oberschwäbischen Barockstraße und an der Schwäbischen Bäderstraße.
Museen
Direkt am Federsee liegt ein Steinzeitmuseum, das 1968 eröffnete Federseemuseum, erbaut von Architekt Manfred Lehmbruck, an das ein Steinzeitdorf angeschlossen ist.
Gedenkstätten
Ein Gedenkstein aus dem Jahr 1981 am Standort der vom NS-Regime vernichteten Synagoge Ecke Hofgartenstraße/Schussenrieder Straße erinnert an die ausgerottete Jüdische Gemeinde und ihr Gotteshaus.[5]
Bauwerke
- Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus, eines der ersten Bauwerke des Klassizismus in Süddeutschland mit noch spätbarocker Ausstattung, errichtet von 1774 bis 1776 von Pierre Michel d’Ixnard als Umbau einer gotischen Kirche. Die Ausstattung umfasst Stuckplastiken von Johann Joseph Christian und Malereien von Johann Friedrich Sichelbein.
Persönlichkeiten
Ehrenbürger
- Lina Hähnle (1851–1941), Gründerin und erste Vorsitzende des Bundes für Vogelschutz
Söhne und Töchter der Stadt
- Karoline Kaulla (1739–1809), Hoffaktorin am württembergischen Hof
- Hermann Einstein (1847–1902), Unternehmer und Vater von Albert Einstein
- August Fischer (Apotheker) (1868 - 1940), Apotheker, Firmengründer von Uhu (Klebstoff)
- Hans Kayser (1891–1964), Komponist und Musiktheoretiker
- Johannes Rövenstrunck (*1949), Komponist
Personen, die in Bad Buchau wirkten
- Kurt Prokscha, Dirigent und Musikdirektor der Stadt
- Eduard Mörike, wohnte 1828 bei seinem Vetter im ehemaligen Stift Buchau
Anmerkungen
- ↑ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Bevölkerungsstand
- ↑ 200 Buchauer Juden und den 57 eingewiesenen Juden
- ↑ Rudi Multer: Pogrom in Oberschwaben. In Bad Buchau legten die Nazi-Schergen zweimal Feuer. In: Schwäbische Zeitung vom 8. November 2008
- ↑ Joseph Mohn: Der Leidensweg unter dem Hakenkreuz.. Aus der Geschichte von Stadt und Stift Buchau. Selbstverlag, Buchau 1970
- ↑ Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd.I, Bonn 1995, S. 21, ISBN 3-89331-208-0
Literatur
- Johann Daniel Georg v. Memminger: Stadt Buchau, aus Beschreibung des Oberamts Riedlingen. Cotta, Stuttgart und Tübingen 1827 (Volltext bei Wikisource)
Weblinks
Städte und Gemeinden im Landkreis BiberachAchstetten | Alleshausen | Allmannsweiler | Altheim | Attenweiler | Bad Buchau | Bad Schussenried | Berkheim | Betzenweiler | Biberach an der Riß | Burgrieden | Dettingen an der Iller | Dürmentingen | Dürnau | Eberhardzell | Erlenmoos | Erolzheim | Ertingen | Gutenzell-Hürbel | Hochdorf | Ingoldingen | Kanzach | Kirchberg an der Iller | Kirchdorf an der Iller | Langenenslingen | Laupheim | Maselheim | Mietingen | Mittelbiberach | Moosburg | Ochsenhausen | Oggelshausen | Riedlingen | Rot an der Rot | Schemmerhofen | Schwendi | Seekirch | Steinhausen an der Rottum | Tannheim | Tiefenbach | Ummendorf | Unlingen | Uttenweiler | Wain | Warthausen
Wikimedia Foundation.